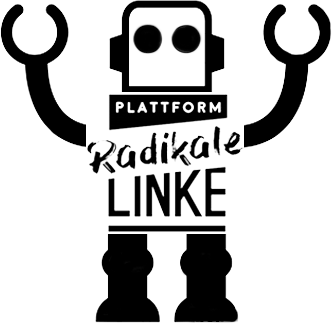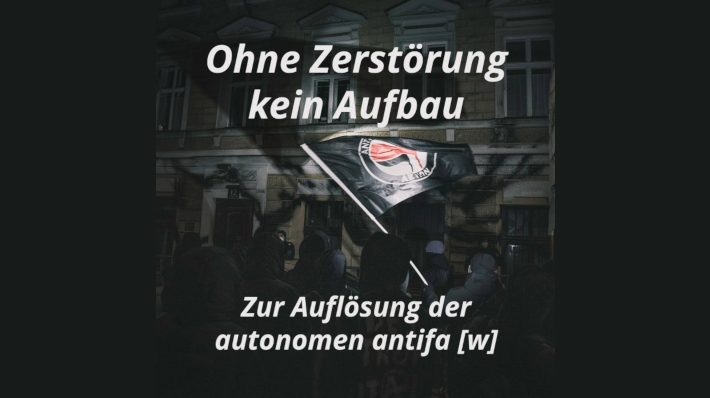Wir wollen den bevorstehenden Internationalen Hurentag, den 2. Juni, nutzen, um zur Solidarisierung mit Sexarbeiter*innen und ihren Kämpfen aufzurufen.
Am 2. Juni 1975 besetzten in Lyon (Frankreich) Sexarbeiter*innen über mehrere Tage eine Kirche, nachdem sie vermehrt Opfer von Polizeirazzien wurden. Seitdem wird an diesem Tag der International Sex Workers Day begangen, um einerseits gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung, andererseits gegen die ausbeuterischen Arbeits- und Lebensverhältnisse von Sexarbeiter*innen zu protestieren und mehr Rechte für Sexarbeiter*innen zu fordern.
Unsere Kämpfe zu verbinden ist uns besonders wichtig, da aktuell viele Länder in Europa das 1999 in Kraft getretene „Schwedische Modell“ zum Vorbild nehmen. Unter dem Deckmantel feministischen Denkens wird vorgegeben, das Patriarchat abschaffen zu wollen, indem der Sexkauf verboten wird. Ein Gesetz gegen den Kauf von Dienstleistungen bestraft jedoch nicht nur die Käufer*innen (vornehmlich Cis-Männer), sondern auch die Anbieter*innen sexueller Dienstleistungen. Ergänzend zum Sexkaufverbot und der de facto Illegalisierung von Sexarbeit verunmöglicht das sogenannte „Kuppeleigesetz“ es, Räume an Sexarbeiter*innen zu vermieten, was deren Arbeit quasi verunmöglicht und Betroffene häufig weiter in die gesellschaftliche Unsichtbarkeit drängt.
Die so befeuerte Kriminalisierung und Repression von Sexarbeit führt nicht zur Beendigung derselben, sondern macht sie für ihre Akteur*innen prekärer und gefährlicher durchzuführen. Die Schaffung von Verbotszonen in Wien, die den Straßenstrich vom zentral gelegenen Prater in die Außenbezirke Wiens verlagerte, wo Sexarbeiter*innen keinerlei Infrastruktur zur Verfügung steht, ist ein eindrückliches Beispiel für diese Entwicklung. Die buchstäbliche Verdrängung und Unsichtbarmachung bestimmter Arbeiten nach dem Motto „Was wir nicht sehen, betrifft uns nicht“, ist Teil der Logik von Carearbeit bzw. ihrer Ausbeutung. Sexarbeit als Arbeit anzuerkennen, bedeutet, diese Arbeitsbedingungen zu bekämpfen. Sie als bestimmte Form von Arbeit – als Carearbeit – zu verstehen, bedeutet, die enorme gesellschaftliche Abwertung und Unsichtbarmachung dieser Arbeit sichtbar zu machen und zugleich ihre Spezifik, das Zusammentreffen verschiedener Ausbeutungsverhältnisse, im Vergleich zu anderen Tätigkeiten nicht auszublenden.
Care/Sorge/Reproduktion…
Im Folgenden schreiben wir abwechselnd und teils synonym von Care-, Sorge- und Reproduktionsarbeit, weil wir diese Debatten nicht trennen wollen. Außerdem wollen wir damit der Komplexität von Care/Sorge/Reproduktion gerecht werden und Offenheit in ihrer Analyse bewahren.
Wir verorten uns mit der Verwendung von Care und Sorge in Debatten um Soziale Reproduktion und setzen uns damit in Bezug zu wichtigen Kämpfen von Feminist*innen aus den 70er und 80er Jahren und ihren Fragen zu Kapitalismus, Ausbeutung und Geschlecht. Zentral dabei war die Erkenntnis, dass der Kapitalismus auf vergeschlechtlichten Trennungen in Lohnarbeit/produktive Arbeit und Reproduktionsarbeit/unproduktive Arbeit, sowie der Aufspaltung von Öffentlichkeit und Privatheit beruht. Produktive Arbeit, also im klassischen Sinne herstellende Arbeit, wurde historisch als männliche Sphäre durchgesetzt und der Öffentlichkeit zugeordnet. Ihr gegenüber galt und gilt die reproduktive Sphäre als Private und traditionell weiblich assoziierte Sphäre. Dieser Sphäre wird in der marxistischen Auslegung die Wiederherstellung von Arbeitskraft (etwa durch Kochen) oder ganzer Lebenszyklen (durch Gebären) zugerechnet und als unproduktive Arbeit abgewertet. Und auch historisch haben sich hierarchische Geschlechterrollen maßgeblich durch die Verdrängung von feminisierten Körpern aus der Öffentlichkeit und vergeschlechtlichte Arbeitsteilung durchgesetzt. Diese gewaltvolle Konstruktion und ihre Konsequenzen gilt es anzugreifen. Daraus ergeben sich feministische Analysen zu reproduktiver Arbeit als jene Arbeit, die ohne Bezahlung und abgewertet zumeist von Frauen und feminisierten Körpern im Zuhause und der Familie verrichtet wird oder schlecht bezahlt und prekär auf migrantische Pflege- oder Hausarbeiter*innen ausgelagert wird.
Gleichzeitig knüpfen wir an migrantische, Schwarze bzw. BIPOC, proletarische sowie trans und queere Perspektiven auf Reproduktionsarbeit an, um die oft sehr binär und weiß/eurozentristisch geführten Debatten herauszufordern und zu überschreiten. Denn die strikte vergeschlechtlichte Trennung von männlicher Lohnarbeit/Öffentlichkeit und weiblicher Reproduktionsarbeit/Hausarbeit hat nie für alle gegolten und nie in ihrer ‚Reinform‘ existiert. Sie ist ein bürgerliches, weißes und patriarchales Ideal. Nie konnten (und wollten) sich alle Menschen in diese Zweiteilung fügen!
Schwarze und of Colour Feminist*innen haben aufgezeigt, dass die wirtschaftlichen Bedingungen, die der Unterscheidung zwischen Öffentlich und Privat zugrundeliegen, Frauen of Color selten zugutegekommen sind und das Private eine andere Bedeutung hat [FN1]. Für von Armut Betroffene und Arbeiter*innenfamilien ließ sich die Trennung ebenso nicht aufrechterhalten, weil das Private nicht unbedingt mit zu Hause und das Öffentliche nicht unbedingt mit Arbeit verknüpft wurde. Zugleich hat die Transnationalisierung von Arbeit und Care dazu geführt, dass reproduktive Tätigkeiten wie Reinigung, Pflege oder Kinderbetreuung am Markt von jenen gekauft werden können, die es sich leisten können und auf diese Weise großteils an migrantisierte Hausarbeiter*innen oder Pflegekräfte ausgegliedert wird.
Für trans, inter oder queere Personen fand Reproduktions-/Care-/Sorgearbeit schon immer jenseits der binären Trennung männlicher Öffentlichkeit und weiblicher Privatheit statt: beispielsweise nicht in der Form klassischer Hausarbeit in der Hetero-Ehe und Kernfamilie, sondern als Community-Care, mit dem Ziel in einer cis- und heteronormativen Welt zu überleben.
Mit diesen Kritiken wird einmal mehr deutlich, wie komplex intersektionale Herrschaftsmechanismen zusammenwirken und die Trennung in zwei getrennte vergeschlechtlichte Bereiche immer gewaltvoll durchgesetzt, und als Ideal wirkmächtig war. Wir verstehen Care-/Sorge-/Reproduktionsarbeit als gesellschaftlich notwendige Arbeit, die für das Fortbestehen und Überleben der Gesellschaft, von Menschen und Communities notwendig ist. Im Kapitalismus wird Reproduktionsarbeit notwendigerweise abgewertet, um sie maximal ausbeutbar zu machen. Diese Abwertung und Ausbeutung ist z.B. durch das Ideal und die Institution der bürgerlichen Hetero-Kernfamilie abgesichert, sie wird mit Zuschreibungen von Privatheit, Liebe, Romantik, Erholung und Harmonie (und Nicht-Arbeit) aufgeladen, wie durch den bürgerlichen Staat, der diese Verhältnisse (vergeschlechtlicht und rassifiziert) organisiert. Eine emanzipatorische und widerständige Perspektive auf Carearbeit kann sich dementsprechend nicht darauf ausruhen, sie grundsätzlich als gut oder schlecht zu bewerten.
…und Sexarbeit
Ähnlich facettenreich, wie die angedeuteten verschiedenen Dimensionen der Carearbeit, verhält es sich auch mit dem Feld der Sexarbeit – und insbesondere dem Blick auf sie. Sexarbeiter*innen irritieren die Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem und die damit verbundene Disziplinierung und Kontrolle von (weiblicher) Sexualität, die krampfhaft und moralisierend aufrechtzuerhalten versucht wird. Ihre Verdrängung aus der Öffentlichkeit, aus der Sichtbarkeit der bürgerlichen Mitte, ist dabei nichts Neues, sondern hat die Funktion diese Herrschaftsverhältnisse und gesellschaftlichen Trennungen zu stabilisieren. Die Stigmatisierung, Unsichtbarmachung und moralische Abwertung von Sexarbeit folgt einem alten patriarchalen Schema. Die Rollenangebote, die das Patriarchat für feminisierte Körper bereithält, bewegen sich zwischen Ehefrau und Hure, wie die bürgerliche Zurückhaltung der Hysterie gegenübergestellt wird: Sie sind moralisch aufgeladene Konstrukte, die einer klaren Abwertungslogik folgen, denn was aus der Norm fällt, wird geächtet.
Zugleich ist Sexarbeit besonders für trans Personen und Migrant*innen mit prekären Aufenthaltsstatus häufig eine der wenigen möglichen Arbeitsfelder, in denen sie arbeiten können, da sie von dem cis-sexistischen und rassistischen Arbeitsmarkt ausgeschlossen und diskriminiert werden. Sexkaufverbote („Schwedisches Modell“) lösen diese Situation nicht, da sie weder rassistische Migrationsregime aushebeln noch vergeschlechtlichte Arbeitsverhältnisse und kapitalistische Ausbeutung bekämpfen. Der Kampf um politische und Arbeitsrechte ist also insofern nicht „nur“ ein Kampf um Anerkennung, sondern für viele marginalisierte Gruppen ein Kampf ums Überleben! Diese Kämpfe müssen wir gemeinsam und solidarisch führen.
Jene, die sich für ein Sexarbeitsverbot einsetzen, tragen nicht zu einem Ende von Gewalt bei, sondern stabilisieren gewaltvolle Zustände. Die Soziologin Laura María Agustín spricht von einer „Rettungsindustrie“, die mehr Schaden anrichtet als hilft und sich aus dem Begehren nach Unschuld speist. Es ist das Begehren, kein Freier zu sein und keinesfalls an der Unterdrückung von ‚Frauen‘ beteiligt zu sein.
Die Debatten um Ausbeutung von Erntehelfer*innen und Personen in Privathaushalten oder am Bau werden selten mit derselben emotionalen Vehemenz geführt. Auch werden männliche Sexarbeiter nicht in derselben Weise viktimisiert und voyeuristisch dargestellt wie ihre weiblichen Kolleginnen. Und auch wenn wir es müde sind, das erklären zu müssen, nochmals zur Verdeutlichung: Natürlich reden wir hier über Sexarbeit, zu deren Ausübung sich volljährige Menschen selbst entscheiden und nicht über Menschen-/Frauen-/Kinderhandel. Die Frage nach der Freiwilligkeit von Erwerbsarbeit muss im Kapitalismus ohnehin negiert werden: globale Ungleichheiten, Klasse und Geschlecht verengen die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Branchen noch einmal mehr. Sexarbeiter*innen die Entscheidungs- und Zurechnungsfähigkeit abzusprechen und pauschal zu sagen, dass alle Opfer sind und es nur nicht wüssten, ist allerdings Ausdruck eines patriarchalen Neo-Paternalismus.
Mit der Illegalisierung von Sexarbeit geht die gewaltvolle Repression seitens der Polizei einher. Erniedrigungen, Razzien und polizeiliche Übergriffe gegen Sexarbeiter*innen sind weltweit dokumentiert [FN2]. Der carcerale Feminismus (Elizabeth Bernstein), der die Bestrafung der Freier fordert, richtet sich auch gegen Sexarbeiter*innen. „Aber um wirklich etwas gegen diese Form von Gewalt zu tun, müssten wir uns als Gesellschaft eingestehen, dass wir bestimmte Formen von Gewalt gegen Frauen zulassen, um den sozialen und sexuellen Wert anderer Frauen zu erhalten“, schreibt Mithu M. Sanyal.
Gemeinsam ist vielen Care-Berufen neben der körpernahen Tätigkeit die vergeschlechtliche Konnotation von Sorge, Liebe und Verfügbarkeit als vermeintlich natürliche weibliche Eigenschaft, die als Gegenteil professionalisierter Tätigkeiten dargestellt wird. Sexarbeit als Carearbeit zu benennen bedeutet, auf die Überschneidung rassistischer und sexistischer Arbeitsdiskriminierung zu fokussieren und so Gemeinsamkeiten zwischen der Ausbeutung von (migrantischen) Pflegekräften, Haushalts- und Reinigungskräften und von Sexarbeiter*innen zu betonen. Das politische und strategische Ziel ist, die Kämpfe der Arbeiter*innen zu verbinden, um gemeinsam gegen rassistische, sexistische und kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung aufzutreten.
Dabei dürfen wir keineswegs den Fehler machen, Carearbeit (und die ihr zugeschriebenen Tätigkeiten) zu romantisieren oder sie als dem kapitalistischer Logiken entgegengesetzt zu verstehen. Carearbeit findet in Abhängigkeitsverhältnissen statt, die mit extremer Gewalt einhergehen, die tödlich sein können. Gleichzeitig sind reproduktive sorgende Tätigkeiten nicht per se abzuschaffen, nur weil sie in kapitalistische Verhältnisse integriert werden, sondern umzugestalten. Sie können uns lehren, uns anders zueinander in Beziehung zu setzen, statt vereinzelt oder in heteronormativen Kernfamilien, und damit die strukturelle Sorglosigkeit des Kapitalismus nicht zu akzeptieren.
Wenn wir Sexarbeit in Beziehung zu Carearbeit stellen, meinen wir nicht, dass mensch automatisch ein Recht darauf hat, seine sexuellen Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Wir denken auch nicht, dass wir per se ein Recht darauf haben, im Alter von einer schlecht bezahlten, migrantischen 24-h-Betreuerin gepflegt zu werden und die Wohnung geputzt zu bekommen. In einer patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft finden wir die Frage nach wahrhaftigen oder legitimen Bedürfnissen nicht zielführend, wir alle sind in unseren Wünschen und Abhängigkeiten von dieser Gesellschaft geformt. Carearbeit über die Legitimität von Bedürfnissen her zu definieren, ist also nicht möglich. Das gilt genauso für Sexarbeit. Aus der Perspektive des feministischen Streiks blicken wir aber darauf, unter welchen Bedingungen wer sorgt und wer versorgt wird. Hier können wir von Schwarzen, queeren Kämpfen und der Krüppelbewegung lernen: Wem werden sexuelle Bedürfnisse und Lust überhaupt zugestanden? Wem ist es überhaupt möglich, unter diesen gesellschaftlichen Verhältnissen Lust zu leben? Hier eröffnet Sexarbeit abseits von heteronormativen und ableistischen Vorstellungen neue Räume – was nicht bedeutet, dass nicht auch diese Räume durch Kapitalismus, Rassismus, Ableismus und Patriarchat vorstrukturiert sind.
Die Tatsache, dass unser Begehren gesellschaftlich hergestellt ist, impliziert, dass es von Normen geprägt ist und wir selbst lookistische, ableistische, rassistische Ausschlüsse mitproduzieren. Doch Sexarbeit vermag auch mit hegemonialen (und heteronormativen) Vorstellungen von Sexualität zu brechen. Dass es auch queere, trans, inter, nicht-binäre Sexarbeit gibt und auch Sexarbeit von Cis-Männern für (Cis-)Frauen, wird bei den Debatten meist völlig ausgeklammert.
Das Feld der Sexarbeit ist vor allem deshalb so schwer zu begreifen, weil es so vielfältige Formen annimmt, und dort so viele strukturelle Abwertungen zusammenkommen. Deshalb können wir nur kollektiv und im Austausch miteinander verstehen, wie diese komplexen gesellschaftlichen Verhältnisse zusammenwirken und nur so können wir Werkzeuge zu ihrer Bekämpfung entwickeln. Als AG Feministischer Streik versuchen wir mit dem Mittel des Feministischen Streiks, reproduktive sorgende Tätigkeiten zu politisieren und zu bestreiken. Eine solche Bestreikung bringt alle gesellschaftlichen Verhältnisse ins Wanken, die auf ebenjene Tätigkeiten angewiesen sind. Wir halten es für notwendig, vor allem Kämpfe in diesen abgewerteten Bereichen zu unterstützen und solidarisch mit jenen zu sein, die von gesellschaftlichen Ausschlüssen aufgrund dieser Abwertung und Unsichtbarmachung betroffen sind und massive staatliche Gewalt und Marginalisierung erfahren. Denn eine Entsolidarisierung mit Sexarbeitenden ist auch eine Entsolidarisierung mit trans Personen, mit migrantisierten und illegalisierten Menschen, mit Prekarisierten und Marginalisierten.
Die Spaltung von Sorgearbeiter*innen: das Hurenstigma
Bürgerliche Moralvorstellungen spielten und spielen eine wesentliche Rolle bei der Durchsetzung binärer und hierarchischer Geschlechterverhältnisse. Weibliche Sexualität wurde ins Private gedrängt, diszipliniert und tabuisiert. Zwischen der Figur der „Heiligen“ in Form von Mutter/Hausfrau und der „Hure“ im Sinne von Frauen, die ihre Sexualität öffentlich leb(t)en, hatte und hat wenig Platz. Dies ging und geht einher mit der Konstruktion des öffentlichen Raumes als gefährlich und des Häuslichen als sicheren Ort für Frauen. Wir wissen u.a. aus unseren Auseinandersetzungen mit patriarchaler Gewalt und Femi(ni)ziden, dass dies eine Lüge ist.
Vergewaltigung in der Ehe galt in Österreich bis 1989 nicht als Straftatbestand und auch in den aktuellen Debatten um Sexarbeit zeigt sich die Vorstellung von moralisch richtigem Sex in der romantischen Beziehung, welche als gewaltfrei imaginiert wird, und moralisch falschem Sex, der im Bereich des Öffentlichen und im Austausch für Geld stattfindet. Tatsächlich sind beide Formen von Sex (Ehe und Sexarbeit) vertraglich abgesichert und in beiden Fällen spielen oft ökonomische, gesellschaftliche und andere Zwänge eine Rolle. Die Stigmatisierung und Moralisierung von Sexarbeit und die Darstellung von Frauen darin als passive Opfer, reproduziert diese patriarchalen Dichotomien viel mehr, als dass sie sie bekämpft. Gerade Sexualität ist wie kein anderer gesellschaftlicher Bereich von Machtverhältnissen, Moral und Scham geprägt. Scham ist wiederum eine der repressivsten und nutzlosesten Praxen, sie dient ausschließlich dazu, Subjekte entlang der bürgerlichen Moral zuzurichten und zu disziplinieren.
Precarias a la Deriva, ein feministisches Kollektiv aus Spanien, erklären in ihrem Buch „Was ist dein Streik?“, warum die Abwertung von Sexarbeit als Kontinuum des Hurenstigmas gelesen werden kann:
„Sexarbeiterinnen haben traditionell eine Herausforderung der Vertragsbedingungen dargestellt, denn indem sie Sex anboten/fabrizierten, verlagerten sie ihn vom Bereich der Reproduktion in den der Produktion und vom Privaten ins Öffentliche. Das Stigma der Huren rührt von dieser Subversion des Geschlechtermandats her, das dem Vertrag eingeschrieben ist, zumal dieser den Frauen ein an Ehe und Reproduktion gebundenes, duckmäuserisches Modell der Sexualität auferlegt. Das Stigma, das dazu führt, dass Prostitution nicht als Beschäftigung erachtet wird, ebenso wie die Zusammensetzung des Kollektivs der Sexarbeiterinnen (größtenteils Migrantinnen und oftmals ohne Papiere) und der Mangel an Räumen, in denen diese Profession ausgeübt werden kann, rufen ernsthafte Arbeitsrisiken hervor. Hier liegt denn auch der Ausgangspunkt für die Forderung nach Rechten: Papiere für alle, arbeitsrechtliche Regulierung des Sektors sowie spezifische und angemessen Orte zur Ausübung der Arbeit.“
Das Hurenstigma inkludiert nicht nur sexistische und misogyne, sondern auch antisemitische Elemente. ‚Die Sexarbeiterin‘ galt historisch als zweideutige Figur, als Entartete, Asoziale, in der sich Natur und Ware vereint. Hier deckt sich das Bild der Sexarbeiterin mit der Abwertung von Juden*Jüdinnen: Das Aufweichen von Geschlechterrollen, bzw. das Verlassen ihres zugewiesenen gesellschaftlichen Platzes, wurde und wird in antisemitischen Narrativen Juden*Jüdinnen angehaftet. Wie Karin Stögner in ihrem Essay „Geist und Sexus“ schreibt, wurde die Lust auf Geld sowohl Juden*Jüdinnen, als auch Frauen unterstellt. Die Frau, die „ihren Körper verkauft“ und sich dabei noch dazu der Reproduktion entzieht, „höhlt den Volkskörper von innen her aus“. „Zudem widerspricht die Prostituierte dadurch, dass sie Sex gegen Geld und nicht gegen ein Kind gibt, keinen Stammhalter erzeugt, der weiblichen Rolle im bürgerlichen System der Selbsterhaltung.“
Aus all den genannten Gründen erscheint uns deshalb wichtig, unsere Kämpfe mit jenen von Sexarbeiter*innen zusammen zu führen, statt uns spalten zu lassen. Im Zuge der „Wages for Housework“-Debatten geschah dies bereits. Black Women Wages for Housework haben sich in Kämpfe von Sexarbeiter*innen eingebracht und 1974 schrieb Silvia Federici dazu:
„We want and must say that we are all housewives, we are all prostitutes, and we are all gay, because as long as we accept these divisions, and think that we are something better, something different than a housewife, we accept the logic of the master.“
Wie wir mit Rückgriff auf die Kämpfe und Interventionen von BiPoCs, trans oder der Krüppelbewegung gezeigt haben, ist immer wieder zu reflektieren, wer in diesem „wir“ gemeint ist. Als AG Feministischer Streik stellen wir uns gegen diese Logik und Unterteilung von Carearbeit in „schmutzige“ Sexarbeit und „saubere“ Pflege- und Sozialberufe, denn darin sehen wir eine Reproduktion der Dichotomie „Hure und Heilige“, die in sich sexistisch und misogyn ist, und anhand derer Frauen über Jahrhunderte eine selbstbestimmte Sexualität abgesprochen wurde.
Gegen die Spaltung: gemeinsame politische Perspektiven
Es ist eine zentrale feministische Erkenntnis, dass Carearbeit – sei es Kindererziehung, Pflege von Alten und Kranken, Reinigungsarbeiten, Beziehungspflege – nicht romantisch ist, sondern harte Arbeit, die ebenso in Gewaltverhältnissen stattfindet. Jede Carearbeit ist zutiefst von Herrschaftsverhältnissen durchzogen, insbesondere von Geschlechter- und rassistischen Verhältnissen und wird überwiegend von feminisierten und migrantisierten/rassifizierten Menschen verrichtet. Sie wird unter großteils prekären Umständen mit geringem rechtlichen Schutz im informellen Rahmen geleistet. Rassistische Gesetze führen zu Unterdrückung und Diskriminierung, was die Situation am Arbeitsmarkt noch prekärer macht, die Organisierung zur Durchsetzung ökonomischer Interessen extrem erschwert und dazu führt, dass Menschen unter besonders menschenverachtenden Arbeitsbedingungen ausgebeutet werden.
Mit der Verortung von Sexarbeit im Kontinuum von Carearbeit stellen wir uns gegen die Hierarchisierung verschiedener Carearbeitsfelder. Wir fordern die Aufwertung ALL DIESER prekären, vergeschlechtlichten, rassifizierten und abgewerteten (Care-)Tätigkeiten, um die strukturellen Bedingungen, die sie abwerten und ausbeutbar machen, grundlegend zu verändern. Es geht schließlich darum, alles zu verändern und umzuwerfen! Damit haben wir auch zum Ziel, diese Tätigkeiten und Arbeitsfelder nicht in Konkurrenz zueinander zu stellen und die bestehende Hierarchie nicht zu reproduzieren, die die moralistische Unterscheidung zwischen angeblich ‚reinen‘ und ‚guten‘ (weiblichen) Tätigkeiten und ’schmutziger‘, ‚verwerflicher‘ Arbeit hervorruft.
Feministische Zugänge dekonstruieren das Bild der romantischen Liebesbeziehung und zeigen deren gesellschaftliche Gewordenheit auf. Die Professionalisierung und vertragsmäßige Ausverhandlung von Sex ermöglicht die Entschleierung der Romantisierung der Sexualität, die per se mit Macht zu tun hat. Dennoch: Geht es um Sexarbeit, scheinen auch Linke (pro)Feminist*innen plötzlich ihr romantisches Liebesleben verteidigen zu müssen – abermals eine moralisierende Wiederholung von „Hure und Heilige“. Um eine emanzipatorische feministische Perspektive entwickeln zu können, muss es doch genau darum gehen, mit Federici gesprochen alle „Kämpfe um Reproduktion zu kollektivieren“ und aus der Brille der (sozialen) Reproduktion, die Verhältnisse zu analysieren und kollektiv anzugreifen!
Aus unserer Sicht ist es notwendig, gegen die Spaltung der Sorgearbeiter*innen einzutreten – gerade vor dem Hintergrund, wer diese Arbeit verrichtet, nämlich vorwiegend Migrant*innen, trans Sexarbeiter*innen und all jene, die permanent vom System ausgegrenzt werden.
Die Kritik, dass Kämpfe oft bei der Forderung nach Anerkennungen und Akzeptanz stehenbleiben, ohne dass eine weitergehende Perspektive entwickelt wird, muss ernst genommen werden und trifft die gesamte aktuelle Linke.
Demgegenüber ist es in dieser Debatte zentral, über die wichtige realpolitische Perspektive von Entkriminalisierung, Entstigmatisierung und Institutionalisierung der Interessenvertretung hinauszugehen. Wenn Sexarbeit als Arbeit gefasst wird, sind Klassensolidarität, der Kampf um Rechte und die Selbstorganisation der Arbeitenden (also Ausgebeuteten) zentrale Bestandteile der antikapitalistischen Antwort – nicht als Utopie, sondern als notwendige Bedingung der Möglichkeit einer weiterreichenden Perspektive.
Dass (Sex-)Arbeiter*innen von manchen Linken nicht als Subjekte sozialer Kämpfe und Klassensolidarität anerkannt werden, sondern nur als passive Opfer, die es zu retten gilt, erstaunt uns. Es führt zu einer weitgehenden Spaltung von Arbeiter*innenkämpfen und feministischen Bewegungen.
Der Feministische Streik ist für uns ein revolutionäres Mittel, indem er Kämpfe verbindet, statt sich auf identitären und widerspruchsfreien Posten auszuruhen.
Sexarbeiter*innen organisieren sich! Komm am 2. Juni zum Urban-Loritz Platz und zeig dich solidarisch!
Auf zum 2. Juni! Auf zum Feministischen Streik!
[FN1]: Die nicht entlohnte häusliche Arbeit von Schwarzen Frauen wurde mehr als eine Form des Widerstands verstanden, denn als eine Form der Ausbeutung durch Männer, die Privatsphäre als geschützter Bereich, wo Schwarze Frauen frei sprechen konnten. Und auch die Vorstellung von zu schützendem Subjekt und häuslicher Mutter in der reproduktiven Sphäre galten nie oder selten für Schwarze und of Colour Frauen. „Es sei Träumerei, sich Schwarze Frauen als einfach als Hausfrauen vorzustellen…“ (Beal 1969) „Für People of Colour gibt es so etwas wie eine private Sphäre nicht, außer der, die sie in einem ansonsten feindlichen Umfeld zu schaffen und zu schützen vermögen.“ (Hurtado 1989)
[FN2]: „Sowohl Sexarbeiter:innen als auch geschlechtlich non-konforme/gender non-conforming Menschen wurden sexualisiert, mit Kriminalität verknüpft, Konversionstherapie und/oder strafrechtlicher Rehabilitierung ausgesetzt und pathologisiert (insbesondere in Verbindung mit Kindheitstrauma und Missbrauch). Sowohl trans Personen als auch Sexarbeiter:innen werden von der Polizei und der bürgerlichen Justiz immer noch systematisch als Opfer oder als ’nacktes Leben‘ betrachtet. Diejenigen die sie angreifen, vergewaltigen und/oder töten, werden meistens nicht strafrechtlich verfolgt (vor allem, wenn es sich bei den Tätern um Vertreter der Justiz handelt), oder sie werden entlastet, verteidigt, als ob sie selbst angegriffen worden wären […], oder sie werden schlicht für nicht verfolgenswert gehalten (vor allem, wenn es sich bei den Opfern um Migrant:innen, Menschen ohne Papiere oder indigene Menschen handelt)“ (Lewis 2017)
Literatur:
Collins, Patricia Hills (1991): Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. New York: Routledge.
Beal, Frances M. (1969): Double Jeopardy: To Be Black And Female. In: Morgan, Robin (Hg.): Sisterhood is Powerful. An Anthology of Writings from The Women’s Liberation Movement. New York: Vintage Books 1970. S. 382-396.
Dalla Costa, Mariarosa/James, Selma (1973): Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft. Berlin: Merve.
Federici, Silvia (2012): Aufstand aus der Küche. Reproduktionsarbeit im globalen Kapitalismus und die unvollendete feministische Revolution. Münster: Kitchen Politics. Edition assemblage.
Hurtado, Aída (1989): Relating to Privilege: Seduction and Rejection in the Subordination of White Women and Women of Color. Signs, 14(4), 833–855. Online: http://www.jstor.org/stable/3174686
Stögner, Karin (2014): Antisemitismus und Sexismus. Historisch-gesellschaftliche Konstellationen. Baden-Baden: Nomos.
Stögner, Karin (2014): Geist und Sexus. Benjamins Sprachphilosophie als Jenseits des Geschlechterprinzips. Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 8(2), 292–303.
Lewis, Sophie (2017): SERF ‘n’ TERF. Online: https://salvage.zone/serf-n-terf-notes-on-some-bad-materialisms/
Sanyal, Mithu M. (2014): Wenn Sex nicht die Antwort ist, was ist dann die Frage? In: Gira Grant, Melissa: Hure spielen. Die Arbeit der Sexarbeit. Hamburg: Nautilus.
Precarias a la Deriva (2014): Was ist dein Streik? Militante Streifzüge durch die Kreisläufe der Prekarität. Precarias a la deriva. Wien/Linz: Transversal Texts.