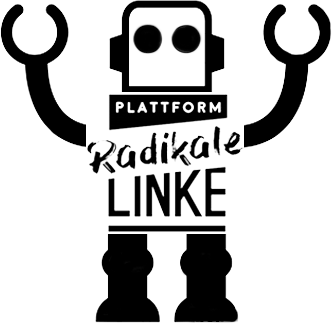In Österreich und Europa erleben wir ein diffuses Zusammenspiel von ökonomischen, (sicherheits-)politischen und sozialen Umwälzungen. Es fühlt sich an, als würden sich Ereignisse verdichten, als wäre auf einmal mehr los als die letzten Jahre. Der Terror von Rechts, ob von islamistischen oder klassischen Faschist*innen, erreicht zu oft sein Ziel, Angst zu verbreiten und rechtsextreme Positionen groß zu machen.
Nicht nur die Verschärfung der Sicherheitspolitik, der Abbau bis hin zur faktischen Abschaffung des Rechts auf Asyl, sondern auch die generelle autoritäre Zuspitzung staatlichen Handelns wird zumeist, wo nicht beklatscht, doch zumindest als neue Normalität hingenommen. In Zeiten immer größerer Unsicherheit, sozialer Abstiegsängste und immer stärker wachsenden Drucks sich den Zwängen und Anforderungen des Marktes anzupassen, kommt es zu einer Hochblüte autoritärer Politik durch den kapitalistischen Wettbewerbsstaat auf der einen und der Akzeptanz reaktionärer Ideologien auf der anderen Seite. Das alles ist kein Zufall. Werfen wir einen Blick auf die Veränderungen, die Zusammenhänge von österreichischer und europäischer Politik, den Rechtsruck, der sich durch die gesamte Bevölkerung zieht und den Kapitalismus als das Problem, über das niemand reden will.
Abschiebung, Abschottung, Überwachung
Mit welchen Veränderungen haben es wir also zu tun? Worin zeigt sich der Rechtsruck und Aufschwung rassistischer und reaktionärer Ideologien? Der Versuch einer Lagebeschreibung der aktuellen Krisensituationen in Österreich und Europa: Am offensichtlichsten zeigt sich eine autoritäre Zuspitzung des Staates in seiner Reaktion auf angebliche Bedrohungen von „Außen“. Mit dem Argument, die Souveränität und die Grenzen des Staates zu schützen, wird eine immer stärker militarisierte Abschottungs- und Abschiebepolitik gerechtfertigt. Die Abschiebung von Geflüchteten mit Militärflugzeugen und der Einsatz von Bundesheer-Spezialeinheiten inklusive Panzern an der Grenze sollen die Durchsetzungsfähigkeit des österreichischen Staates beweisen. Diese Zuspitzung geht mit einer gleichzeitigen Normalisierung ehemals deutlich von rechts besetzter Forderungen einher, wie beispielsweise die Propagierung einer „Festung Europa“ – einst eine Position der extremen Rechten, wird sie heute von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen.
In Zeiten offensichtlicher Krise müssen Geflüchtete – und Andere, welche nicht als Teil der nationalen Gemeinschaft wahrgenommen werden – als Verursacher*innen der gesellschaftlichen Probleme herhalten. Und wenn die „Fremden” an allem Schuld sind, wird der Staat als Beschützer der nationalen Gemeinschaft angerufen. Der Staat kann die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus nicht verhindern. Er muss von seiner offensichtlichen Machtlosigkeit gegenüber globalen ökonomischen Entwicklungen ablenken. Der Staat ist nicht in der Lage die Bevölkerung vor den Abgründen des Kapitalismus zu schützen. Um sich jedoch trotzdem der eigenen Stärke und Souveränität zu versichern, reagiert Österreich mit militärischer Symbolik und autoritärer Politik. Neben diesen, auf Abschreckung zielenden Politiken der Abwehr vermeintlicher Bedrohungen „von Außen“, fällt das Herstellen „innerer Sicherheit“ ebenfalls in den staatlichen Aufgabenbereich. So zeigen sich Entwicklungen hin zu einem autoritären Staat auch in Gesetzesbeschlüssen, wie dem neuen Staatsschutzgesetz. Massive Überwachung und die Erweiterung polizeilicher und verfassungsschutzlicher Befugnisse stehen im Zentrum. Unter dem Deckmantel der Prävention werden die repressiven Organe ausgebaut. Polizeiliche Ermittlungen sind noch vor einem konkreten Tatverdacht möglich, filmen und beobachten polizeilicher Kontrollen wird zugleich unter Strafe gestellt. Ohne nennenswerte Kritik wird diese als normal hingenommene autoritäre Zuspitzung vollzogen.
Die Kulturalisierung sozialer Konflikte
Während ein öffentlicher Diskurs über Sicherheit, in welchem die nationale Idylle als permanent bedroht dargestellt wird, überpräsent ist, steht es um das Thematisieren sozialer Sicherheit schlecht. Sicherheit wird nur jenen Personen garantiert, die ökonomisch verwertbar sind. Personen, die der gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen können, wollen oder dürfen, bleibt hingegen ein Anspruch auf Sicherheit weitgehend verwehrt. Zusätzlich werden ihnen aufgrund ihrer prekären Situation negative Eigenschaften zugeschrieben (aggressiv, nutzlos, kriminell etc.), was dazu führt, dass sie als „Sicherheitsrisiko“ gelten. Strukturelle Probleme werden in rassistischer Manier als „kulturelle Unterschiede“ präsentiert. Dass vorrangig Personen ohne österreichische Staatsbürger*innenschaft in illegalisierten Gewerben arbeiten (müssen) liegt jedoch nicht an ihrem Berufswunsch, sondern ist das Resultat einer Situation, die wenige Alternativen offen lässt. Die Folgen kapitalistischer Verwertungslogik, z.B. Armut, werden als Ursache gesellschaftlicher Probleme verkannt. Daraus resultiert die Bekämpfung unerwünschter Personengruppen anstatt der Bekämpfung der Ursache. Wie sich eine solche Politik äußern kann, zeigte sich etwa an der Operation Spring (1999/2000) und dem Mord an Marcus Omofuma (1999), die schnell in Vergessenheit geraten sind. Aktuell macht die „Bekämpfung des Drogenproblems rund um die U6“ die Kontinuität rassistischen Vorgehens der Exekutive deutlich – und wird oftmals, wenn nicht aktiv gefordert, als normaler Teil des Alltags akzeptiert. Offen rassistisch wird alles Schlechte als die Schuld „der Muslime“, „der Ausländer“ oder „der Flüchtlinge“ erklärt. Besonders ekelhaft werden solche Beschuldigungen, wenn österreichische Sexisten glauben, „ihre Frauen“ vor „fremden“ Männern schützen zu müssen: Frauen* sollten am Besten nur mehr in Begleitung aus dem Haus gehen. Der rechte Mann kann sich dabei als heldenhafter Beschützer inszenieren und gleichzeitig den eigenen Sexismus auf „die Anderen“ projizieren: Sexistische und sexualisierte Gewalt gegen Frauen* wird hierbei nicht in ihrer Alltäglichkeit in der österreichischen/europäischen Gesellschaft begriffen, sondern wird kulturalisiert, also als angeblich „kulturelles Problem“ von Nicht-Österreicher*innen thematisiert. Die grundsätzlich patriarchale Struktur der Gesellschaft wird ohnehin geleugnet.
Der Wunsch nach Autorität
Unsere Zeit ist also geprägt von Phänomenen, die man als Ausdruck von Entsicherung bezeichnen kann. Ständig wird über Krisen geredet: Auf die „Wirtschaftskrise“ folgt die „Flüchtlingskrise“, seit Jahrzehnten wird nur noch übers Sparen gesprochen. Österreich sei pleite, es gäbe kein Geld für Bildung, Pensionen und fürs Gesundheitssystem. In der Gesellschaft ist man sich scheinbar einig, dass es keinen weiteren Aufstieg mehr gäbe, dass das Limit am Finanzierbaren erreicht sei und es ab jetzt bergab geht. Der scheinbare Verlust von Ordnung und Sicherheit macht Angst. Die Antwort ist der Wunsch nach einem “starken Mann” der Stabilität bringt. “Lieber weniger Freiheit als Chaos.” Die Autoritären sind in der Offensive. Ob FPÖ, „Identitäre“, türkische oder polnische Nationalist*innen, islamistische und jihadistische Gruppen: Sie alle versprechen eine andere politische Ordnung, und zwar ein kompromissloses Regieren für das jeweils eigene „Volk”. Dieses wird entlang der Linien von Nation, Ethnie und/oder Religion bestimmt. Das autoritäre Versprechen lautet: „Ich bin einer von euch und fühle euren Schmerz. Ich beschütze euch vor den Bedrohungen von Außen und bekämpfe die Eliten, die euch in diese Lage gebracht haben. Bei mir kommt ihr wieder zuerst dran.”
Menschenfeindlichkeit, erkennbar in der Betonung von Ungleichwertigkeit und der Verletzung der Würde von Menschen, wird allerdings auch verstärkt in öffentlichen Aussagen und Handlungen aus der gesellschaftlichen Mitte sichtbar. Diese werden dann als Berechtigung für unterschiedliche Formen von Diskriminierungen und Gewaltakten verwendet. Eine ständige Fokussierung der Kritik auf den rechten Rand, sei dieser österreichischer, deutscher, türkischer oder islamistischer Ausprägung, führt leicht zur Entlastung einer vermeintlichen gesellschaftlichen Mitte und der bürgerlich-liberalen Linken. Denn der Rechtsextremismus ist ohne eine diskriminierende, autoritäre Mehrheitsgesellschaft undenkbar. Der Glaube an den starken Mann, der Standortnationalismus und antifeministische Praktiken bleiben wichtige Merkmale vor allem der Konservativen.
Die Revolte gegen die Moderne
Parallel zum Wunsch nach mehr staatlicher Autorität und zum gesamtgesellschaftlichen antifeministischen und rassistischen Backlash werden auf subjektiver Ebene weitere vermeintliche Lösungen in krisenhaften Situationen herangezogen. Diese basieren auf einer Externalisierung, Kulturalisierung und Personalisierung sozialer Konflikte. Besonders deutlich äußert sich das im Auftreten zweier regressiver Bewegungen, die kontinuierlich an Einfluss zu gewinnen scheinen und auf verschiedene Weisen das gesellschaftliche Klima prägen: Die völkisch-rassistische Revolte, deren zentraler Akteur die FPÖ ist, auf der einen Seite und islamistische Strömungen auf der anderen Seite. Erstere betreibt unter dem Vorwand eines angeblichen „Kampfes gegen die Islamisierung“ gegenwärtig vor allem Hetze gegen Geflüchtete und Muslime. Um eine Kritik an tatsächlichen reaktionären islamistischen Tendenzen geht es dabei nicht. Diese würde zwingend die Solidarität mit vor islamistischem Terror und Bürgerkrieg geflohenen Menschen beinhalten, genauso wie die Unterstützung all jener, die beispielsweise in der Türkei, in Kurdistan oder im Iran für Freiheit und Säkularisierung kämpfen. Sie würde die vielen muslimischen Opfer der Terroranschläge benennen, anstatt jeden weiteren Anschlag für die Verbreitung ihres antimuslimisch-rassistischen Bildes zu nutzen, das als willkommener Türöffner für bekannte rechtsextreme Positionen dient und diese in der angstgetriebenen Öffentlichkeit salonfähig macht. De facto handelt es sich aber um die alte völkisch-rassistische Wahnvorstellung eines Kampfes gegen „Überfremdung“, welche sich als „Verteidigung des Abendlandes“ darstellt. Tatsächlich tritt in letzter Zeit aber auch die zweite regressive Bewegung, der islamistische Autoritarismus, verstärkt öffentlich in Erscheinung. Er umfasst eine Bandbreite unterschiedlicher Phänomene, von repressiv-konservativen Gemeinden und Verbänden, über die Pro-AKP Mobilisierungen bis hin zum jihadistischen Terrorismus. Das Verhältnis der beiden „Bewegungen“ erscheint wie ein mythischer Kampf verfeindeter Brüder. Ihre Feindstellung gegeneinander verdeckt nur mühsam die große Ähnlichkeit der beiden Revolten gegen die moderne Gesellschaft: Beide teilen eine Weltsicht, die von abgeschlossenen und unveränderbaren Kulturen ausgeht. Daher versuchen gegenwärtig auch beide Seiten, unabhängig von realen sozialen Gegensätzen wie Klassenverhältnissen, den Gegensatz „Nicht-Muslime vs. Muslime“ als die zentrale Spaltungslinie zu etablieren. Sie sind wechselseitig aufeinander angewiesen und das jeweilige Gegenüber legitimiert den eigenen Kampf gegen die Moderne: Der Islamismus braucht Muslime als ewige Opfer und Abgehängte der westlichen Gesellschaften genauso, wie die völkischen Rassist*innen das islamistische Bedrohungsszenario. Die Sehnsucht nach einer angeblich konfliktlosen, harmonisch-homogenen Gemeinschaft, in der die gegensätzlichen gesellschaftlichen Interessen aufgehoben sind, wird einmal als „Nation“, ein anderes Mal als „Umma“ (Gemeinschaft der Gläubigen) gedacht. Offener Antisemitismus oder verdeckte antisemitische Denkmuster – vor allem in verschwörungstheoretischen Erklärungen sozialer und politischer Phänomene – Männlichkeitskult und Hass auf Frauen* und Homosexuelle und Transsexuelle sowie die Verehrung des Todes als Helden- und Kriegerkult sind weitere wichtige Gemeinsamkeiten.
Wie können wir diesen autoritären Strömungen, angesichts ihres widersprüchlichen Verhältnisses zueinander, nun entgegentreten?
Vereinzelung und Konkurrenz
Die radikale Linke darf sich nicht auf die Scheingefechte eines angeblichen Kampfes der Kulturen einlassen. Es muss darum gehen, die gegenwärtigen Autoritarismen – seien sie völkisch-nationalistischer oder islamistischer Prägung – als das zu kritisieren, was sie sind: reaktionäre Versuche der Krisenbewältigung, auch auf individueller Ebene. Sie sind als Ausdruck der prekären Existenz der Individuen in kapitalistischen Gesellschaften zu begreifen, Schiefheilungen einer fragilen Existenz, die noch fragiler zu werden droht.
In nationalstaatlich-kapitalistischen Gesellschaften wie der österreichischen kann der einzelne Mensch nur überleben, wenn er in der Konkurrenz am Markt besteht. Das erfordert eine enorme Anpassungsleistung: Jede*r Einzelne muss sich selbst und jede Regung des eigenen Lebens den Regeln von Markt und Staat unterwerfen. Man muss sich selbst permanent disziplinieren, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse unterdrücken und leugnen. Man lebt in einem Zustand der ständigen Selbst-Mobilisierung, in dem man sich immer wieder mit anderen vergleichen muss, sie übertreffen will und sich dafür selbst optimieren muss. Die Unterwerfung unter die Anforderungen der Konkurrenz reicht dabei bis tief in die psychische Struktur der Individuen. Sie können diese Selbstzurichtung vor allem dadurch erbringen, indem sie sich auch subjektiv sehr stark mit der Autorität von Markt und Staat identifizieren, die ihnen als „unser Land“/„unsere Wirtschaft“ begegnet. Die Ideale von Konkurrenzkampf, Leistung und Nützlichkeit werden in das Selbstbild übernommen und zu Leitmotiven des eigenen Lebens – die Einzelnen verinnerlichen den äußeren Zwang. Allerdings erwarten die Menschen auch, von der herrschenden Ordnung dafür belohnt bzw. entschädigt zu werden. Sie wollen an der Größe ihres Standortes teilhaben, und sich durch die Stärke der Nation, welche zum Teil des eigenen Ichs geworden ist, selbst stark fühlen. Auch der Vergleich nach unten und der stolze Blick auf den Platz, den sie sich in der Konkurrenz erkämpft haben, soll den von den täglichen Demütigungen angekratzten Selbstwert stabilisieren.
In der gegenwärtigen Krise verschärft sich diese Dynamik. Die in Aussicht gestellte Belohnung für die Unterwerfung (finanzielle Sicherheit, Planungssicherheit, der zu genießende Lebensabend, dass die Kinder es einmal besser haben, usw.) wird immer fraglicher. Mit der Krise des Sozialstaats, der Finanzkrise und der Eurokrise ist die soziale Unsicherheit zunehmend in die Mitte Europas zurückgekehrt und mit ihr eine bedrohliche Ahnung von der Instabilität des globalen Kapitalismus. Die Verarbeitung dieser Veränderungen befördert eine politische Subjektivität, die geprägt ist von Gefühlen der Ohnmacht und Angst und einem diffusen Ungerechtigkeitsempfinden. Die Einzelnen fühlen sich als Spielball anonymer ökonomischer Kräfte. Dafür muss der soziale Abstieg nicht einmal am eigenen Leibe erfahren werden. Abstiegsängste und die leise Ahnung, dass der eigene Standort von der Krise bedroht ist und daher auch die eigene „Belohnung“ in Gefahr ist, reicht, um die Legitimität des gesellschaftlichen Status Quo aus Sicht der Einzelnen erheblich zu schmälern. In ihrer Wut über die eigene Unterwerfung unter eine versagende Autorität werden als Erklärung für das eigene Elend Feindbilder geschaffen, an denen Wut und Hass entladen werden. Die Aggressionen richten sich nie gegen die wahre Ursache des eigenen Leidens – nämlich die Ordnung von Staat und Kapital, weil diese faktisch zu mächtig ist und weil nicht sein kann, was nicht sein darf: Dass am Ende genau jene Autoritäten, denen man das ganze Leben unterworfen hat, Schuld am eigenen Leiden sein könnten. Dass die ganze Selbstzurichtung umsonst gewesen sein könnte, dass sie weder ein schönes, noch ein freies, noch ein sicheres Leben garantiert.
Die kapitalistische Produktionsweise
Die Kritik an diesen Missständen muss an der Wurzel ansetzen. Dafür müssen tiefergehende Zusammenhänge erkannt und verstanden werden. Der Kapitalismus als komplexes System, das in all unsere Lebensbereiche einwirkt und die Regeln des täglichen Miteinanders festschreibt, muss angegriffen werden. Wie dies ganz grundsätzlich funktioniert und welche Rolle Patriarchat und Staat darin einnehmen muss also deutlich gemacht werden:
Der Kapitalismus zeichnet sich gegenüber vorkapitalistischen Produktionsweisen dadurch aus, dass er Ausbeutung und Herrschaft auf Basis vom Privateigentum an den Produktionsmitteln organisiert. Manche besitzen Produktionsmittel, andere haben nur den Verkauf ihrer Arbeitskraft als Einkommensquelle – sie sind also lohnabhängig. Diese Lohnabhängigen werden von den Kapitalist_innen – also den Besitzer_innen der Produktionsmittel – angestellt und ausgebeutet, d.h.: Lohnabhängige erarbeiten mehr, als sie im Tausch für ihre Arbeitskraft an Lohn erhalten. So entsteht der Mehrwert bzw. Profit für den_die Unternehmer_in/Kapitalist_in. Profit ist der eigentliche Zweck der Produktion. Die Befriedigung von Bedürfnissen dient lediglich als Mittel zur Realisierung dieses Zwecks. Hier darf allerdings nicht der Fehlschluss gemacht werden, Kapitalist_innen allein seien für das Übel des Kapitalismus verantwortlich, denn: Unter den Bedingungen der Konkurrenz hat das Handeln von Lohnabhängigen und Kapitalist_innen gleichermaßen Zwangscharakter. Lohnabhängige sind gezwungen ihre Arbeitskraft als Ware am Markt zu verkaufen, um ihre Existenz zu sichern und Kapitalist_innen sind gezwungen permanent ihren Gewinn zu vergrößern um am Markt bestehen zu bleiben.
Zur Rolle des Staates
Um zu gewährleisten, dass sowohl die Kapitalist_innen als auch die Lohnabhängigen sich gegenseitig als Eigentümer_innen anerkennen, braucht es eine Gewalt, die den reibungslosen Ablauf des Tausches garantiert: den Staat. Er sorgt dafür, dass die Konkurrenz und die Ausbeutung in der Gesellschaft nicht in offene Gewalt umschlägt. Dadurch, dass er die Menschen als abstrakt gleiche Rechtssubjekte anerkennt, schreibt er deren ökonomische Ungleichheiten fest, da er damit auch die herrschende Eigentumsordnung verschleiert und reproduziert. Er ist für die Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft als Ganze verantwortlich und damit keineswegs unparteiisch. Denn: Er ist für seine eigene Refinanzierung auf die erfolgreiche Vermehrung der Profite der Unternehmen auf seinem Territorium angewiesen, da er sich maßgeblich durch Besteuerung dieses Kapitals (sowie der aus ihm bezahlten Löhne und der sich daraus ergebenden Kaufkraft) finanziert.
Der Staat ist ein Wettbewerbsstaat, niedrige Löhne stellen seine Erfolgsgrundlage dar. Spätestens mit der seit 2008 akuten Krise des Kapitalismus spitzt sich dieser Wettbewerbsstaat autoritär zu. Das heißt die zunehmende Durchkapitalisierung aller gesellschaftlicher Sphären wird wenn notwendig auch mit Zwang durchgesetzt, was an Griechenland erst kürzlich sehr bildlich vor Augen geführt wurde. Doch auch die augenblickliche autoritäre Zuspitzung und die Militarisierung des Grenzregimes in Österreich sind nicht von dieser Entwicklung zu trennen.
Die Nation wiederum ist der ideologische Kitt, der die gegensätzlichen ökonomischen und sozialen Positionen, die der staatlich verwaltete Kapitalismus unter die Leute bringt, verdeckt. Die Staatszugehörigkeit der Individuen wird zu einer mystischen „Volkszugehörigkeit“, die je nach Bedarf mit einer Kombination aus angeblich gemeinsamer Kultur, Geschichte, Sprache etc. begründet wird. Mit der Realität haben diese nationalistischen Konstruktionen nur bedingt etwas zu tun, jedoch eignen sie sich hervorragend dazu, die staatliche Herrschaft in den naturwüchsigen Ausdruck einer vorbestimmten Gemeinschaft umzudeuten.
Patriarchat und Kapitalismus
Die Versuche einer reaktionären Krisenbewältigung zielen auch darauf ab, festgeschriebene Geschlechterrollenbilder zu stabilisieren und jene Fortschritte, die durch jahrzehntelange feministische Kämpfe erzielt wurden, rückgängig zu machen. Die „Sonderrolle“, die im Kapitalismus Frauen* zugeschrieben wird, muss an dieser Stelle betont werden. Reproduktionstätigkeiten und Lohnarbeit im Care-Sektor sind nicht nur besonders prekär, sie werden gesellschaftlich auch als Aufgabe von Frauen* festgeschrieben.
Der Reproduktionsbereich, der eigentlich außerhalb der kapitalistischen Verwertungslogik steht, ist Voraussetzung für das weitere Bestehen des Systems, auch wenn Teile des Reproduktionsbereichs durch Lohnarbeit erfolgen und in den Kapitalismus eingegliedert sind. Menschen umsorgen, pflegen, aufziehen erfordert keinen Egoismus, wirtschaftliche Rationalität oder Profitdenken, sondern viel mehr Fürsorge, Selbstlosigkeit, Emotionalität und Zuneigung. Dass eben diese Eigenschaften, Gefühle und Haltungen nun als „weiblich“ festgeschrieben und von „männlichen“ Eigenschaften getrennt werden, liegt nicht zuletzt in der fortgeschriebenen Geschichte des Patriarchats begründet. Die als „weiblich“ verstandenen Eigenschaften erfüllen also den Zweck, dass dadurch Frauen* essentiell dazu bestimmt werden, die Reproduktion zu übernehmen. Auch der vermehrte Eintritt österreichischer/westeuropäischer Frauen* in den Bereich der kapitalistischen Verwertungslogik ändert nichts an geschlechtsspezifischen Zuschreibungen und der Entwertung von Reproduktionstätigkeiten. Vielmehr bringt er zumeist eine Doppelbelastung mit sich, da die Reproduktion nach wie vor Frauen* zugeschrieben werden. Um der Mehrfachbelastung von Lohnarbeit und Reproduktionstätigkeiten zu entkommen, werden letztere im Sinne sekundärer Ausbeutungsmechanismen an Migrantinnen* ausgelagert, die sie häufig unter äußerst prekären Arbeitsverhältnissen ausüben.
Anerkennung bringt weder die Lohnarbeit noch die unentlohnten Haushalts-, Erziehungs- oder anderen Tätigkeiten im Reproduktionsbereich. Und mit der Nicht-Anerkennung dieser Tätigkeiten geht die Abwertung der notwendigen Eigenschaften, Gefühle und Haltungen für diese einher.
Die kulturell-gesellschaftliche Herstellung von Geschlechtsidentitäten geht also mit der geschlechtlichen Verteilung der Tätigkeiten im Kapitalismus einher. Das moderne Patriarchat und der Kapitalismus bedingen sich gegenseitig und können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Der Kampf gegen den Kapitalismus muss immer auch ein feministischer Kampf sein.
Die befreite Gesellschaft erkämpfen
Eine linke Kritik, die sich damit begnügt den „Abbau des Sozialstaats“ zu beklagen, sich auf die „gute, ehrliche Arbeit“ beruft und mehr staatliche Intervention in Zeiten der Krise fordert, hat nicht verstanden, dass sie so den Mitverursacher und Betreuer von Armut und Zwang als rettende Instanz anruft. Diese Position ist tendenziell offen für nationalistische Diskurse und das Suchen und (Er-)Finden von Sündenböcken. Der Staat ist nicht und war nie ein neutraler „Überbau“ der Wirtschaft, sondern muss als grundlegendes Element der politischen Ökonomie des Kapitalismus kritisiert werden.
Es geht darum, das Verhältnis von Staat, Nation, Patriarchat und Kapital zu verstehen und Ideologien zu reflektieren und zu widerlegen, die uns schon seit unserer Geburt begleiten, uns anerzogen werden und tiefer in uns stecken, als wir manchmal glauben wollen. Sei es die Identifizierung mit der Lohnarbeit, geschlechtsspezifische Rollen und damit einhergehende Erwartungen, das Gefühl der Wertlosigkeit, wenn man in der Schule oder in der Arbeit negativ bewertet wird oder erst gar keinen Job findet.
Eine Veränderung unseres Blickwinkels auf den kapitalistischen Verwertungszwang, auf den kapitalistischen Wettbewerbsstaat und seine Politik, kann uns neue politische Perspektiven und eine neue Sicht auf die (wahnsinnige) Normalität unseres Alltags ermöglichen.
Der Staat wird uns nicht retten, denn der Staat ist Teil des Elends. Und er setzt seine Gewalt ein, durch Gesetze, Aufrüstung und Einschüchterung, wenn seine Legitimität in krisenhaften Zeiten angezweifelt wird. Unsere Möglichkeiten liegen darin, ein Bewusstsein für die uns umgebenden Ideologien zu entwickeln, uns selbst und unabhängig von staatlicher Politik zu organisieren, gesellschaftliche Spaltungen zu benennen und zu bekämpfen. Die Werte dieser unmenschlichen Leistungsgesellschaft sind so gut antrainiert, dass es schwer fällt, sich eine andere Praxis, geschweige denn die Möglichkeit einer anderen Gesellschaft, überhaupt vorzustellen.
Mit der Kampagne “Raus aus der Ohnmacht!” wollen wir als Plattform Radikale Linke dazu aufrufen, nicht trotz, sondern gerade aufgrund der Defensivposition, in der Antikapitalist*innen sich befinden, in die Offensive zu gehen. So notwendig die Abwehrkämpfe gegen weitere Verschlechterungen sind, so notwendig ist es, die Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren: Wenn wir aus dem Hamsterrad der Ohnmacht, der Abwehrkämpfe, der Vereinzelung und Marginalisierung ausbrechen wollen, brauchen wir eine breite, starke und handlungsfähige Radikale Linke!
Die Kampagne soll dazu mobilisieren, Aktionen und Veranstaltungen gegen den Kapitalismus, den Staat und seine autoritäre Formierung zu organisieren. Gleichzeitig stellt dieser Aufruftext den Versuch einer Erklärung der aktuellen Entwicklungen dar. Nur wenn wir uns organisieren und unserer Kritik in Aktionen und Texten transparent und nachvollziehbar Ausdruck verleihen, sie für Menschen zugänglich machen und so als radikale Linke mehr werden, ist Veränderung denkbar!
Die Plattform Radikale Linke ist ein Zusammenschluss vieler linksradikaler Gruppen und Zusammenhänge aus ganz Österreich.