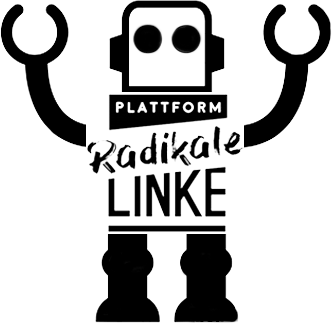Ich darf mich zu Beginn für die Einladung und die Möglichkeit hier zu sprechen bedanken. Ich stelle einmal kurz vor, für wen ich hier spreche: Die “Plattform Radikale Linke“ ist ein Zusammenschluss mehrerer linksradikaler, antiautoritärer Gruppen. Wie sich das gehört, haben wir folglich auch keine Parteilinie, sondern sind durch eine gewisse inhaltliche Heterogenität ausgezeichnet und arbeiten an unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Wir haben uns 2016 im Nachgang des Sommers der Migration gegründet, der ja in Österreich bekanntlich sehr schnell vom nationalen Schweineherbst abgelöst wurde. Die radikale Linke stand damals vor neuen Herausforderungen, nämlich einer enormen Anzahl von sehr raschen rassistischen Mobilisierungen auf der Straße. Stellenweise ist es uns dann auch gelungen, der extremen Rechten, bei ihren Versuchen die Straße für sich zu beanspruchen, Steine in den Weg zu legen. Dennoch war das tatsächlich neu: In Österreich gab es für die extreme Rechte auf der Straße immer wenig Resonanzraum, da sie im Parlament so stark durch die FPÖ vertreten war und ist. Uns ging es darum linksradikale Strukturen aufzubauen, bestehende miteinander zu vernetzen, Aktionsformen auszuprobieren und gesellschaftliche Relevanz zu erringen, um so der extremen Rechten auf der Straße etwas entgegensetzen zu können. Antifaschismus und Antirassismus waren also wichtige Bezugspunkte, mit denen wir uns seit unserer Gründung auseinandergesetzt haben.
Doch um dem Aufstieg der extremen Rechten etwas fundamentales entgegenzusetzen, das war uns auch klar, braucht es mehr als Antifaschismus: Es braucht eine zukunftsgerichtete Perspektive jenseits der bestehenden Verhältnisse. Denn die unvernünftige Einrichtung der bestehenden Verhältnisse kann als Brutkasten reaktionärer Ideologien gesehen werden. Nazis und Rassist*innen fallen ja nicht einfach vom Himmel, sondern sind Produkt dieser Gesellschaft. Und außerdem ist die Situation im Kapitalismus auch ohne Nazis schon schlimm genug. Deshalb beschäftigen wird uns aktuell auch mit den Möglichkeiten von Arbeitskämpfen im Sozialbereich oder mit dem feministischen Streik als Mittel, um die geschlechtliche Reproduktionsordnung der kapitalistischen Gesellschaft in Frage zu stellen.
Wir wollen jetzt zu Beginn ein paar Schlaglichter auf unsere theoretische Kritik werfen und dabei aufzuzeigen versuchen, was das für unsere Praxis heißt. Das wird alles nur sehr holzschnittartig möglich sein. Zum Thema antikapitalistische Theorie und Praxis ließen sich ganze Bibliotheken füllen und man könnte sicher stundenlang darüber reden und hätte noch immer nicht alles Wichtige gesagt. Deshalb wollen wir uns hier auf zwei Punkte zu beschränken versuchen, von denen wir denken, dass die einen Unterschied zu vielen anderen Gruppen machen, die schon da waren oder noch kommen. Zum einen ist das eine Kritik des Fetischismus der bürgerlichen Gesellschaft, mit der für uns auch die Notwendigkeit von Ideologiekritik zusammenhängt. Fetischismus ist ein Begriff, der meint, dass Menschen gewissen Mythen anhängen. So wie beispielswiese Menschen, die aus religiösen Gründen irgendwelche Symbole anbeten. Dass Marx diesen Begriff auf die bürgerliche Gesellschaft anwendet – die von sich selbst behauptet vollends aufgeklärt und rational zu sein – will zeigen, dass die Menschen auch hier Mystifikationen und Verkehrungen unterworfen sind, die den kapitalistischen Verhältnissen entspringen. Zum anderen führen ja mehrere Gruppen in ihrem Namen, dass sie eine Partei sind; und andere wollen da unbedingt hin. Wir wollen kurz versuchen zu erklären, warum wir keine Partei sind und warum eine Kritik der Politik, eine Kritik des Staates unweigerlich zu einer Kritik der politischen Ökonomie dazugehört. Der Kritik der politischen Ökonomie geht es ja nicht um eine andere, bessere Wirtschaftstheorie, sondern um eine fundamentale Kritik der kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft inklusive ihrer Begriffe und Institutionen. So geht es beispielsweise auch nicht darum, den Standpunkt der Arbeit einzunehmen, diese zu romantisieren und zu verherrlichen, sondern um die Abschaffung der Lohnarbeit und um die Selbstaufhebung des Proletariats.
Danach wollen wir euch mit einigen Fotos und Videos noch einen Einblick darüber geben, was wir praktisch so treiben.
Kritik des Fetischismus der bürgerlichen Gesellschaft
Zuerst einmal: Was ist das Wesentliche am Kapitalismus? Kapitalismus ist ein historisch spezifisches System von Herrschaft und Ausbeutung. Man spricht von Kapitalismus, wenn der Warentausch das dominierende Prinzip der gesellschaftlichen Produktion ist. Deshalb beginnt Marx seine Analyse im Kapital auch mit der Ware als Basiskategorie, als Elementarform kapitalistischer Gesellschaften. Grob gesagt ist das Ziel kapitalistischer Warenproduktion nicht die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, sondern die rastlose und selbstzweckhafte Vermehrung von Wert und Kapital, also Profitmaximierung. Bedürfnisbefriedigung ist hier nur ein Nebenprodukt, wenn es sich als „zahlungskräftige Nachfrage“ artikuliert. Das Streben nach Profit passiert nicht, weil einzelne Personen besonders böse oder gierig sind, sondern weil das Prinzip der Konkurrenz sie (bei Strafe des ökonomischen Untergangs) dazu treibt, um damit einen Vorteil gegen andere in der Konkurrenz um Absatzmärkte und Profite zu ergattern. Privatproduzent*innen produzieren für einen anonymen Markt, es ist also kein gesellschaftlich geplanter und deshalb strukturell krisenhafter Prozess.
Das hat auch Implikationen für den gesellschaftlichen Charakter von Arbeit im Kapitalismus: Es geht hier um mehrwertbildende, abstrakt gleiche menschliche Arbeit, die die Grundlage für den Profit ist, und um deren maximale Ausbeutung. Die kapitalistische Form der Produktivitätssteigerung, die eine Form zur Erhöhung der Ausbeutungsrate ist, hat dabei – wie wir immer wieder sehen können – ein enormes destruktives Potential gegen Mensch und Umwelt. Menschen werden als Arbeitskräfte vernutzt oder überflüssig gemacht und natürliche Ressourcen werden ausgebeutet. In der Produktion geht es nicht darum, wer was braucht um nach diesem Maßstab zu produzieren, sondern darum, möglichst viel zu produzieren und abzusetzen, ohne zu wissen, ob was man produziert, sich überhaupt absetzen lässt und gebraucht wird. Der kapitalistischen Produktionsweise ist es herzlich egal, wenn Menschen verhungern obwohl genug für alle da wäre. Ob es den Menschen gut geht (oder nicht) ist nicht Kriterium des kapitalistischen Erfolgsmaßstabs, seiner Rechenweise.
Das verrückte an der Herrschaft im Kapitalismus ist aber nun, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, die von Menschen selbst hervorgebracht werden, als dingliche, natürliche Eigenschaften von Sachen erscheinen. Und damit erscheinen sie auch unveränderbar. Man könnte sagen, die gesellschaftlichen Verhältnisse verselbstständigen sich gegenüber den Produzent*innen. Es gibt hier im Kapitalismus also eine Herrschaft von Sachen, unter deren Kontrolle die Menschen stehen, anstatt sie zu kontrollieren. Marx spricht hier von Fetischismus und Verdinglichung. Man sieht sich den stummen Zwängen dieser Verhältnisse, die sich hinter dem Rücken der Menschen vollziehen, hilflos und ohnmächtig ausgeliefert und das, obwohl das alles nur Resultat unseres eigenen Handelns, unserer eigenen Praxis ist. Es ist Praxis in einem anderen Aggregatzustand, in verhärteter, verknöcherter Form, die unveränderbar erscheint, auch wenn sie von Menschen hervorgebracht wurde und tagtäglich reproduziert wird.
Das ist aber nicht nur ein objektiver Prozess, sondern dieser wiederholt sich auch innerhalb der Menschen: Die Menschen machen sich selbst zu Objekten des gesellschaftlichen Zwangs, verinnerlichen die Herrschaftsimperative von Staat und Kapital. Um diese erträglicher zu gestalten, machen sie sie zu ihrem eigenen Zweck, anstatt sie überwinden zu wollen. Die einzelnen Menschen richten sich also permanent zu staatsloyalen und kapitalproduktiven Subjekten selbst zu; mit all dem Leid und den Entsagungen, die damit einhergehen. Das kennen wir selbst, wenn wir uns früh morgens aus dem Bett quälen und uns zu Tätigkeiten schleppen, die fremdbestimmt sind, die uns keine Erfüllung ermöglichen, wo wir unter einem Kommando und Druck arbeiten, der krank macht. Dieser Anpassungsdruck an die bestehenden Verhältnisse, dieser Konformitätszwang, führt in weiterer Folge auch zu einem Hass auf alles, was sich diesem Zwang tatsächlich oder vermeintlich entzieht: Im Ressentiment gegen Arbeitslose, Jüdinnen und Juden, “Schmarotzer“, “Taugenichtse“, “Querulanten“ drückt sich eine negativ gewendete Wunschvorstellung aus, die auf andere projiziert und an diesen gehasst und verbannt wird. Das, was man selbst nicht haben kann, soll auch kein anderer besitzen. Der Gedanke an Glück muss ausgetrieben werden, wie das Adorno formuliert.
Die eigene Überflüssigkeit und Ersetzbarkeit, die ja auch real erfahren wird, führt zu Ideologien kollektiver Identität wie im Nationalismus und Rassismus. Hier sollen vorpolitische Rechte auf gesellschaftliche Teilhabe, Arbeitsplätze, Sozialleistungen und Privilegien mittels der eigenen „Herkunft“ abgeleitet werden. Und je tiefer verwurzelt dieses Identitätsversprechen ist, desto unumstößlicher scheint es in der allgegenwärtigen Konkurrenz auch zu sein. Hier ist schon angedeutet, dass – wie Marx es formuliert – die Menschen unter den bestehenden Verhältnissen nicht nur geknechtete, sondern auch „verächtliche“ Wesen sind. Dass es die materiellen Verhältnisse sind, die die ihnen Unterworfenen so roh machen. Dass es also objektive Gedankenformen gibt, die der gesellschaftlichen Emanzipation im Weg stehen.
So hat vor allem auch die historische Erfahrung des Nationalsozialismus gezeigt, dass das Proletariat nicht automatisch ein revolutionäres Subjekt ist. Die objektiv Unterdrückten und Ausgebeuteten haben keineswegs auch subjektiv immer das Interesse daran, diese Ausbeutung und Herrschaft abzuschaffen. Viele fliehen in autoritäre Ideologien – weil eine umfassende Veränderung so fern scheint. Real erfahrene Ohnmacht führt also zu autoritären Verheißungen, endlich an der Macht der anderen teilhaben zu können und damit andere zu quälen, um sich für den Schmerz zu rächen, dem man sich unter diesen Verhältnissen selbst auszusetzen hat. Zwar sind die ökonomischen und sozialpsychologischen Strukturen, die autoritäre Einstellungsmuster begünstigen, stets vorhanden, sie müssen aber in bestimmten Konjunkturen erst politisch aktiviert und eingebunden werden. Das ist alles in der Kritischen Theorie von Adorno, Marcuse und Horkheimer sehr gut nachlesbar und ein wichtiger Bezugspunkt unserer Kritik.
Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit eines Antifaschismus, der das Eigeneleben dieser Ideologien ernst nimmt und über die Gefährlichkeit des Umschlagens von bürgerlicher Herrschaft in Barbarei Bescheid weiß. Es ist ja gerade ein wesentliches Merkmal des Rechtsextremismus, dass er die Ideologien und Wertevorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft wie Nationalismus, Sexismus oder Rassismus zuspitzt. Radikaler Gesellschaftskritik geht es demgegenüber um eine Analyse und Veränderung, die an der Wurzel des Problems ansetzt.
Daraus ergibt sich auch die Einsicht, angesichts der offensichtlichen Unvernünftigkeit und Gewaltförmigkeit dieser Verhältnisse, in offene Rebellion gegen sie überzugehen. Diese Lesart der Marx’schen Kritik der politischen Ökonomie, die hier mit der Kritischen Theorie angedeutet wurde, unterscheidet sich gewaltig von jener, die über Jahrzehnte hinweg die dominante Lesart innerhalb der Linken war: Ihnen ging es darum, die von Marx kritisierten Formen und Bewegungsgesetze alternativ für eine sozialistische Wirtschaft anzuwenden, anstatt sie abzuschaffen. Verbunden war das mit einem Revolutionsverständnis, das dem Proletariat eine historische Mission unterstellte und Geschichte als Automatismus hin zum Sozialismus begriffen hat. Die Kritische Theorie drehte dieses Verständnis um: Die Revolution hat nun eher den Charakter einer Notbremse, wie Walter Benjamin sagte – „damit es nicht so weitergeht“, wie Adorno hinzufügte. Wenn man diese Marx-Revision irgendwie begrifflich fassen will, bietet sich der Begriff des Westlichen Marxismus an, der eben die Krise der Arbeiterbewegung im Zuge des 1. Weltkriegs mit seiner Politik der Vaterlandsverteidigung und die Erfahrung des Nationalsozialismus und der Shoah kritisch reflektiert und sich die Frage stellt, warum die Revolution weiter ausbleibt. Neben der Kritischen Theorie spielen da auch Namen wie Gramsci, Lukács oder Althusser eine große Rolle.
Warum wir keine Partei sind: Kritik der Politik und Kritik des Staates
Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt: Der Frage also, warum wir nicht als Partei organisiert sind, warum unsere Praxis nicht darauf aus ist, die staatliche Macht zu erobern.
Uns erscheint parteiförmige Politik nicht als Ort radikaler emanzipatorischer Veränderung. Es ist ja auffällig, dass viele, die mit guten und schönen Zielen in die Politik gehen, diese dann nicht umsetzen (können). Und das liegt nicht daran, dass diese Verrat üben oder korrupt sind, sondern an der Form, in der sich Politik im Kapitalismus bewegt. Form schlägt hier Inhalt, die Institutionen sind stärker als die Menschen, die sich mit ihren Idealen in sie rein begeben. Politik im Kapitalismus ist durch einen engen Korridor der Verbesserungsmöglichkeiten im Bestehenden ausgezeichnet. Wenn du jetzt versuchst Politik in den Institutionen zu machen und es dir um mehr geht als um die etwas bessere Verwaltung des schlechten Bestehenden, rennst du ständig gegen eine Wand, die du irgendwann als Grenze akzeptierst.
Grundlage der Politik sind ja Steuereinnahmen, also eine gelingende Kapitalakkumulation auf ihrem Territorium sicherzustellen. Deshalb muss es der Politik darum gehen, die besten Verwertungsbedingungen für das Kapital zu garantieren, anders würden ihr die Mittel fehlen, überhaupt konkrete Politik umsetzen zu können. Gleichzeitig geht es ihr um die Verwaltung dieser falsch eingerichteten Gesellschaft. Das Institutionengefüge des Staates macht Interessenkonflikte verhandelbar, legitimiert und sichert Herrschaft ab. Es geht darum, gesellschaftliche Konflikte und Widersprüche in für die kapitalistische Gesellschaft funktionale Bahnen zu lenken – um “konstruktive Vorschläge“ und Kompromissbildung, wie das dann genannt wird. “Konstruktive Kritik“ will Verbesserung und Verfestigung des Zustands und nicht dessen Abschaffung. Dysfunktionale Positionen, also Sachen, die den Betrieb stören, werden hier verbannt, bekämpft oder versucht zu integrieren. Der Staatskritiker Johannes Agnoli hat das als permanente, gewaltförmige, aber unblutige Konterrevolution beschrieben. In „Die Transformation der Demokratie“ hat er sich ganz genau angeschaut, wie der Staat diesen Prozess der Integration organisiert und dass angesichts der zunehmend „verhärteten Form“ von Politik nichts mehr grundlegend Emanzipatorisches von ihr zu erwarten ist. Er spricht hier vom Sachzwangcharakter der Politik und von einem pluralen Einparteiensystem, weil die politischen Positionen der verschiedenen Parteien zunehmend ununterscheidbar werden.
Deshalb organisieren wir uns im sozialen Raum der Gesellschaft. Vor allem müssen emanzipatorische Veränderungsprozesse schon immer auch ein Vorschein auf die bessere, befreite Gesellschaft sein. Deshalb organisieren wir uns antiautoritär und versuchen entgegen der staatlichen und kapitalistischen Logik gesellschaftliche Gegenmacht aufzubauen. Der Staat ist kein Gegenspieler zum Kapital, sondern sichert dessen Rahmenbedingungen ab. Er ist kein Fahrrad, mit dem man einfach in eine andere Richtung fahren kann.
Beispiele linker Parteien in Europa in letzter Zeit zeigen zudem, dass diese, wenn dann nur gemeinsam mit sozialen Bewegungen an Stärke gewinnen konnten. Sichtbar wurde aber leider auch, was wir schon aus der Vergangenheit kennen: Die linke Syriza konnte in Griechenland so reibungslos wie keine andere Partei die Austeritätspolitik durchsetzen, obwohl sie für das genaue Gegenteil gewählt wurde. Hier wird erkennbar, dass sich staatliche Politik immer wieder an den Zwängen und übergreifenden Dynamiken der Weltmarktkonkurrenz bricht. Gleichzeitig zeigen Bewegungen wie die der Gelbwesten, Fridays4future oder #enteignen, dass man auch ohne Partei Einfluss auf staatliche Politik gewinnen kann. Es sind vor allem soziale Bewegungen, die Inspiration liefern, die Konflikte sichtbar machen und grundlegende Veränderungen anstoßen.
Insgesamt: Wenn es uns darum gehen soll, dass wir eine ganz andere Lebens- und Beziehungsweise der Menschen ohne Konkurrenz, Ausschluss und Herrschaft erkämpfen wollen, dann muss sich das auch in der Art und Weise niederschlagen, wie wir uns im hier und jetzt organisieren und wie wir unsere Kämpfe führen. Diese Frage lässt sich nicht auf den Tag nach der Revolution vertagen.
Theorie und Praxis – um abschließend noch einmal auf das Thema der Lehrveranstaltung zurückzukommen – sind wichtige Bezugspunkte unserer Organisierung, die wir kollektiv wollen. Ohne Erfahrungen, die man macht, wenn man sich ganz praktisch gegen die herrschenden Institutionen stellt, bleibt jede theoretische Reflektion ungenügend. Anders herum aber auch: Wenn ich keine theoretische Kritik betreibe, kann ich das, was ich erfahre, nicht adäquat einordnen. „Herzustellen wäre ein Bewusstsein von Theorie und Praxis, das beide weder so trennt, dass Theorie ohnmächtig würde und Praxis willkürlich“ schreibt Adorno. Aufgabe einer radikalen Linken muss es sein durch Theorie und praktische Vermittlung die Möglichkeit von Veränderung und Emanzipation wieder denkbar zu machen und wachzuhalten. Und so auch ganz konkrete Angebote zu machen, die die Interessen und Bedürfnisse der Menschen betreffen. Denn eines ist klar: Eine Welt frei von Hunger, Leid, Zwang und Elend ist jetzt schon möglich, die Voraussetzungen sind gegeben und es ist genug für alle da. Dafür müssen wir aber ganz grundsätzlich etwas an der Art und Weise ändern, wie die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion gestaltet ist. Und das heißt den Kapitalismus in seiner Gesamtheit, samt Staat, Patriarchat und Nation abzuschaffen.
Wir organisieren regelmäßig inhaltliche Veranstaltungen, beispielsweise im Rahmen des monatlichen Antifa-Cafés und auch abseits davon. Wir organisieren aber auch Demonstrationen und andere Aktionen, beteiligen uns an Bündnissen, und sind teilweise mit verschiedenen linksradikalen Gruppen in ganz Europa vernetzt.