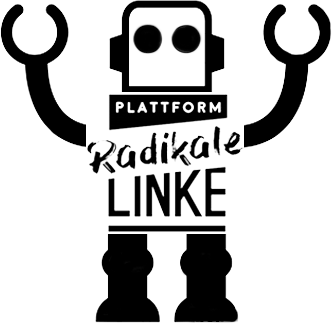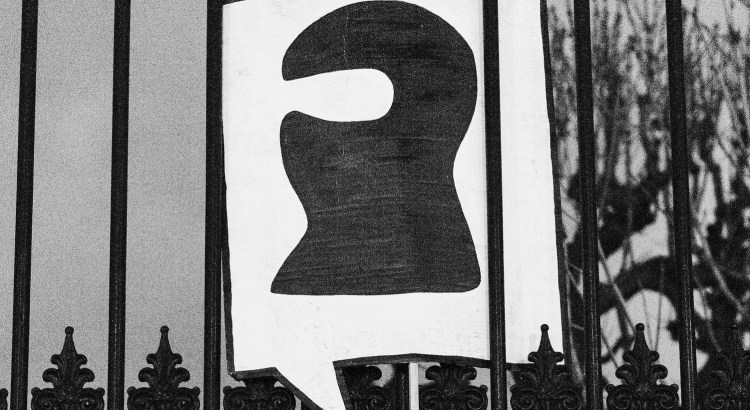Als am Donnerstag, den 27. August 2015, dutzende Menschen tot in einem LKW auf der Ostautobahn im österreichischen Burgenland entdeckt wurden, war das Entsetzen groß. Mehr als 70 Flüchtende erstickten bei dem Versuch von Ungarn über die Grenze nach Österreich zu gelangen. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner zeigte sich schockiert über die Resultate ihres eigenen politischen Handelns und sprach von einem „dunklen Tag“ der „uns alle betroffen macht“, um im selben Atemzug eine „Aktion scharf gegen Schlepper“ anzukündigen. Das europäische Grenzregime, das Menschen auf der Flucht in lebensbedrohliche Situationen zwingt, hatte nun auch in Österreich einer großen Zuschauer_innenzahl seine mörderischen Konsequenzen offenbart. Währenddessen saßen tausende Refugees am Hauptbahnhof in Budapest fest, da die ungarische Polizei ihnen die Weiterreise verwehrte. Ohne ausreichende Versorgung und teilweise Angriffen von Nazis und/oder Polizei ausgesetzt beschlossen sie, sich zu Fuß auf einen Marsch Richtung österreichische Grenze aufzumachen und forderten dadurch das Migrationsregime erneut heraus. Mit Erfolg! Der selbstorganisierte Protest und die anhaltenden Kämpfe von Flüchtenden brachten in weiterer Folge das Dublin-System ins Wanken. Seitdem begann sich das einzupendeln, was uns bis heute bekannt ist: Die Regierungen fast aller europäischen Staaten diskutieren über Grenzschließungen, den Ausbau der Festung Europa und die „Sicherung der Außengrenzen“, über Asylrechtsverschärfungen und Kapazitätsgrenzen.
In der österreichischen Zivilgesellschaft entwickelte sich spätestens nach jenem 27. August ein Problembewusstsein. Während einer antirassistischen Demonstration am 31. Oktober in Wien kamen die ersten Refugees mit einem ganzen Zug von Ungarn am Westbahnhof an. Als an diesem Tag über 25.000 Menschen in Wien auf die Straße gingen, baute gleichzeitig ein weiterer Teil der Zivilgesellschaft spontane und lang anhaltende Solidaritätsstrukturen auf, um die fehlende staatliche Unterstützung mit dem Notwendigsten auszugleichen. Konvois mit bis zu hundert Autos brachen in den Folgetagen aus Wien und anderen Städten auf, um Fluchthilfe zu leisten und damit die Festung Europa politisch anzugreifen. Am 3. Oktober fand in Wien erneut eine antirassistische Großdemonstration statt, der sich über 50.000 Menschen anschlossen. Als Gruppe organisierten wir einen antinationalen Block, an dem sich Hunderte beteiligten, um auf der Demo zum Ausdruck zu bringen, dass humanitäre Hilfe zu leisten zu wenig ist und Antirassismus und die Kritik an der Festung Europa auch immer eine Kritik an nationalstaatlicher Ausgrenzung sein muss. So hieß es in unserem Aufruf: „wie es keine Atomkraftwerke ohne Atommüll geben kann, keinen Kapitalismus ohne Krise, kann es auch keinen Nationalstaat geben, ohne die beständige gewaltsame Ausgrenzung von Nicht-Staatsangehörigen.“ [1] Nach der Demo fand ein Konzert mit 100.000 Menschen unter dem Motto „Voices for Refugees“ auf dem Wiener Heldenplatz statt. Aufgrund der großen Teilnehmer_innenzahl und am Charakter der Veranstaltung kurz vor der Wien-Wahl konnte man sich als aufmerksame_r Beobachter_in der österreichischen Verhältnisse schon ausmalen wohin das Ganze führt: Einem großen Teil der Konzertbesucher_innen ging es wohl nicht vordergründig um Geflüchtete. Im besten Fall ging es jenen darum, ihr Gewissen zu beruhigen oder einfach die Toten Hosen zu sehen, im schlechtesten Fall ging es um nationale Identifikation, um die Inszenierung als das „bessere Österreich“. So verwundert es kaum, dass die Veranstalter_innen den Bundespräsidenten zur Ansprache baten. Es handelte sich um eine zutiefst unpolitische Veranstaltung, deren politische Momente sich eher an nationalen Identitäsbegehren, anstatt an einer Kritik an diesen entfaltete.
Am Wochenende darauf zeigte sich, dass diese unkritische Symbolpolitik nichts an den realen Kräfteverhältnissen ändern kann. Die rechtsextreme FPÖ gewann in Wien ordentlich dazu, nahezu jede_r dritte Wähler_in hat in Wien einer völkisch-nationalistischen Partei mit Verbindungen zum Neonazismus ihre Stimme gegeben. In Stadtteilen wie Simmering, traditionelle Arbeiter_innenviertel, wurde die FPÖ erstmals stärkste Kraft. Auch in Oberösterreich bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen hatte die FPÖ starke Zuwächse zu verzeichnen und stellt seitdem gemeinsam mit der konservativen ÖVP eine rein männliche (2015!) Landesregierung.
Der Sommer des Helfens wurde nun auch offiziell vom nationalen Schweineherbst abgelöst. Die gesellschaftspolitische Debatte um Flucht und Migration wurde zunehmend von rechts dominiert und der in der österreichischen Gesellschaft schlummernde Rassismus brach sich zunehmend Bahn. Während die FPÖ bislang die autoritären Gebärden der von Abstiegsängsten und rassistischen Untergangsszenarien gebeutelten Österreicher_innen für ihren parlamentarischen Erfolg kanalisieren konnte, artikulierte sich dieser Rassismus nun auch zunehmend auf der Straße. In Spielfeld, jenem oststeirischen Ort an der österreichisch-slowenischen Grenze, der den Rechten zum Symbolbild des „Asylchaos“ geworden zu sein scheint, fanden nahezu im Wochentakt rassistische Aufmärsche gegen Geflüchtete mit bis zu 600 Teilnehmenden statt. Am 15. November mobilisierte erstmals die „Identitäre Bewegung“ nach Spielfeld, um im Zusammenspiel mit Neonazis und „besorgten Bürgern“ ihre Menschenverachtung auf die Straße zu tragen und Flüchtenden ihr „NO WAY“-Banner entgegen zu halten. Wir beteiligten uns maßgeblich am Bündnis „Kein Spielfeld für Nazis“, welches Gegenproteste organisierte. [2] Aus Wien reisten vier Busse zur Demo an, mittels Fingertaktik und zivilem Ungehorsam wurden Polizeiketten durchflossen und an zwei Punkten die Aufmarschroute blockiert. Trotz dieser Blockaden, welche teilweise von Neonazis gewaltsam durchbrochen wurden, konnte der Aufmarsch zwar stattfinden, wurde aber empfindlich gestört und verzögert. Im Anschluss gingen noch 80 Autos der angereisten Rechtsextremen kaputt.
Vereinzelt fanden auch „Proteste“ gegen die Unterbringung von Geflüchteten statt. Es ist zu befürchten, dass diese Art von rassistischer Mobilmachung noch zunehmen könnte. Die österreichische Regierung hat ein Durchgriffsrecht beschlossen, um Unterkünfte in Gemeinden eröffnen zu können, auch wenn diese dem nicht zustimmen. Trotz der vereinzelten Versuche, auf der Straße eine außerparlamentarische rassistische Bewegung zu etablieren, bleibt der erfolgreichste Arm der völkisch-nationalistischen Rechten ohne Zweifel die FPÖ. Um deren gesellschaftlichen Erfolg zu erklären, macht es Sinn einen Blick auf die Entwicklungsgeschichte und den ideologischen Charakter dieser Partei zu werfen.
Die FPÖ zwischen Rechtsextremismus und Neonazismus [3]
Die Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) ging 1955 aus dem Verband der Unabhängigen (VdU) hervor, welcher sich als Vertreter der ehemaligen NSDAP-Mitglieder sah und seine Reihen mit diesen füllte. Es war ein Sammelbecken von Altnazis, Deutschnationalen und wenigen Nationalliberalen. Letztere wurden mit der Auflösung des VdU und der Umgestaltung zur FPÖ aus der Partei gedrängt, um diese auf einen strikt deutsch-völkischen Kurs zu bringen. Die weitere Geschichte der FPÖ kann als stetiger Kampf zwischen dem deutsch-völkischen und dem nationalliberalen Flügel innerhalb der Partei beschrieben werden. Dieser ständigen Konflikts erschwert die Darstellung der ideologischen Ausrichtung der FPÖ; Diese wirkt oft widersprüchlich und kann auch wegen der Länge des Textes nicht vollständig aufgeschlüsselt werden.
Als erster Bundesparteiobmann wurde Anton Reinthaller gewählt. Dieser war seit 1930 Mitglied der NSDAP, Angehöriger der Regierung um Seyß-Inquart und später SS-Brigardeführer. In seiner Antrittsrede betonte er in deutschnationaler Manier, „der nationale Gedanke bedeutet in seinem Wesen nichts anders als das Bekenntnis der Zugehörigkeit zum deutschen Volk.“ Reinthaller wurde nach seinem Tod 1958 von Friedrich Peter in seiner Position als Bundesparteiobmann beerbt. Auch dieser war ehemaliges Mitglied der SS und der Einsatzgruppe C zugeteilt, welche maßgeblich an Massenerschießungen beteiligt war. Die Liste von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern bzw. Wehrmachts-, SS-Angehörigen und anderen NS-Täter_innen, welche sich der FPÖ anschlossen könnte schier endlos weitergeführt werden. Doch schon diese beiden können gut als Beispiel dafür angeführt werden, dass in Österreich nach 1945 keine Aufarbeitung, geschweige denn ein vollständiger Bruch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit erfolgte. Damit verbunden ist auch eine wenig bis gar nicht erfolgte Aufarbeitung mit der Epoche vor dem Nationalsozialismus in Österreich – des sogenannten Austrofaschismus. Im Vordergrund steht dabei häufig die Betonung des eigen- und widerständigen Österreichs im Gegensatz zum nationalsozialistischen Deutschland. Dass unter dieser als Ständestaat verharmlosten Epoche nicht nur ein unterwürfiges Sozialpartnerschaftsdenken geschaffen wurde, welches Kapital, Arbeit und Staat – bis heute – unter dem nationalen Dach zu vereinen weiß, sondern auch der Weg für den Nationalsozialismus bereitet wurde, wird häufig vergessen.
Mit dem „Anschluss“ an das deutsche Reich wurden schließlich die Wünsche der „Volksdeutschen“ befriedigt. Sie durften endlich „heim ins Reich“ und so sahen auch prominente Sozialdemokrat_innen wie Karl Renner dem „Anschluss“ „mit freudigem Herzen“ entgegen. Nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft und dem Verbot, sich wieder an das „deutsche Vaterland“ anzuschließen, stand die Politik wieder vor dem leidigen Thema Nationalbewusstsein, da die Gründung der Republik – wie schon 1918 – gegen den Willen der „Volksgenossen“ stattfand. Es wurde versucht, einen Österreich-Patriotismus durch Abgrenzung zum Nationalsozialismus und Überbetonung des österreichischen Widerstands aufzubauen. Dies spielte bei der Etablierung des Opfermythos eine wichtige Rolle, welcher Österreich als erstes Opfer des Nationalsozialismus darstellt. Das bot der nationalen Identität wieder einen positiven Bezugsrahmen und machte es möglich, sich mit der österreichischen Nation zu identifizieren, ohne sich den Verbrechen des Nationalsozialismus stellen zu müssen.
War die FPÖ in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens eine Kleinpartei und bewegte sich zwischen 5 und 10 Prozent der Wähler_innenstimmen, erlebte sie mit dem Aufstieg Jörg Haiders und einem damit verbundenen Kurswechsel einen stetigen Aufschwung. Haider erlangte in einer Kampfabstimmung 1986 gegen den national-liberalen Norbert Steger das Amt des Bundesparteiobmanns und brachte die Partei wieder auf einen völkisch-nationalistischen Kurs. Haider baute die FPÖ zu einer autoritären Führerpartei um und verlieh ihr eine ideologische und personelle Erweiterung. Der bis in die Mitte der 1990er verfolgte Deutschnationalismus erwies sich als nicht mehr breitentauglich und wurde von einem „aggressiven Österreichpatriotismus“ [4] abgelöst. Die FPÖ wurde zum Sammelbecken verschiedener ideologischer Strömungen, welche von neoliberal bis national-sozial reichten. Auch in der Familienpolitik wurden Änderungen vorgenommen. Die „österreichische Familie“ stellte schon immer einen zentralen Punkt in der Politik der FPÖ dar. Wurde aber im Parteibuch unter Norbert Steger noch darauf hingewiesen, dass man gegen die Diskriminierung „anderer, frei gewählter Formen des Zusammenlebens“ sei, so lehnte die FPÖ seit Jörg Haider gleichgeschlechtliche Partner_innenschaften dezidiert ab. Diese Fraktionierung innerhalb der Partei führte zu einer ersten Spaltung. Der liberalere Flügel (fünf Abgeordnete) der FPÖ trat 1993 nach dem Erstarken des völkischen Flügels aus der Partei aus und bildeten das Liberale Forum (LIF).
Jörg Haider sorgte mit seinen Aussagen zum Nationalsozialismus immer wieder für Aufsehen. Unter anderem verwies er in einer Rede im Kärntner Landtag darauf, dass das Dritte Reich eine „ordentliche Beschäftigungspolitik“ gehabt hätte. In einem Interview mit der Presse bezeichnete er die FPÖ als „Schädlingsbekämpfungsmittel für die Demokratie“, welche in Österreich von „Schwarzen und Rothäuten, die nicht – wie üblich – im Reservat leben“ [5] regiert würde. Mit solchen Aussagen und dem zuvor erwähnten Kurswechsel gelang es bei der Nationalratswahl 1999 zur zweitstärksten Partei aufzusteigen und an der Regierungsbildung beteiligt zu werden. Der Koalition von ÖVP und FPÖ trat ein breiter Widerstand entgegen. Einerseits auf nationaler Ebene in Form von wöchentlich abgehaltenen Donnerstagsdemonstrationen und andererseits auf internationaler in Form von EU-Sanktionen. Dies verhinderte schließlich eine aktive Regierungsbeteiligung von Jörg Haider und die FPÖ musste die Regierungsreihen mit unbekannteren Gesichtern des moderateren Flügels füllen. Der Konflikt zwischen den Haideranhänger_innen und den FPÖ-Regierungsmitgliedern führte 2002 zur Einberufung eines außerordentlichen Parteitags. In Knittelfeld erfuhr die FPÖ einen weiteren Rechtsruck, was zu Rücktritten und schließlich zu Neuwahlen führte. Bei diesen verlor die FPÖ beinahe zwei Drittel ihrer Wähler_innenstimmen, wurde aber trotzdem an der neuen Regierung beteiligt.
2005 kam es zum endgültigen Bruch. Die immer autoritär-neoliberalere Politik von Jörg Haider und seiner „Buberlpartie“* verlor an Rückhalt der völkisch-nationalistischen Parteibasis. Dies führte schließlich zum Austritt Haiders aus der FPÖ, der mit einem kleinen Teil seiner Anhänger_innenschaft das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) gründete, welches aber – außer in Haiders Kärntner Wahlheimat – erfolglos blieb. Nach dem „tragischen“ Tod der Führerfigur 2008 kann das BZÖ endgültig als unwichtig eingeschätzt werden. Heinz-Christian Strache wurde 2005 zum neuen Parteiobmann der FPÖ gewählt und setzte auf eine strikte Oppositionsstrategie. Damit erreichte die Partei bei den folgenden Wahlen große Erfolge.
Heribert Schiedel, Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW), meint, dass es seit 2005 zu einer Re-Ideologisierung der FPÖ kam. Die heutige FPÖ ist ein Sammelbecken von rechtsextremen Ideologien mit guten Verbindungen zum Neonazismus. Dabei nehmen die seit 2005 innerhalb der Partei wiedererstarkten Burschenschaften eine wichtige Schanierfunktion ein, womit ein offeneres Bekenntnis der FPÖ zum völkischen Deutschnationalismus verbunden ist. So wird beispielsweise bei Angelobungen von allen Abgeordneten der FPÖ die blaue Kornblume (Zeichen des Deutschvölkischen und Symbol für verbotene Nazis in der Zwischenkriegszeit) getragen und sich zur „deutschen Kulturgemeinschaft“ [6] bekannt.
Die Verbindungen zum Neonazismus können gut an der Diskussion um das Verbotsgesetz, welches jede Wiederbetätigung im Sinne des Nationalsozialismus verbietet, aufgezeigt werden. 2006 forderte die FPÖ eine (teilweise) Abschaffung dieses Verfassungsgesetzes unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit. Damit werden die NS-Propaganda und Leugnung von NS-Verbrechen als legitime Meinungen verharmlost. In öffentlichen Debatten distanziert sich die FPÖ zwar vom Nationalsozialismus, doch immer verbunden mit dessen Relativierung und/oder Selbst-Viktimisierung. So werden häufig die NS-Verbrechen mit den angeblichen „Kriegsverbrechen“ von Partisan_innen oder dem „Bombenterror“ [7] der Alliierten aufgerechnet. Auch beim Thema Wehrmachtsdeserteure wird eindeutig Stellung bezogen. Für Strache sind diese „Täter“, die „Unschuldige am Gewissen“ [8] hätten.
Ein weiteres Merkmal der FPÖ ist ihr (struktureller) Antisemitismus. Dieser äußert sich vor allem in ihren Krisenanalysen und in einer ressentimentgeladenen Kritik an den Oberflächenerscheinungen des Kapitalismus, kann sich aber nach Auschwitz nur mehr in codierter Form äußern. Dabei werden keine sozioökonomischen Verhältnisse kritisiert, sondern die Schuld wird einer unmoralischen kleinen Personengruppe zugewiesen. „Internationale Spekulanten“ [9] , „raffgierige Bankmanager“ [10] und „Heuschreckenunternehmen“ [11] hätten die Krise verschuldet und werden zum Feindbild erklärt. So verwundert es auch nicht, dass auch im Nahostkonflikt eine klare Stellung bezogen wird. Der „Zionistenstaat“ Israel führe einen „Vernichtungsfeldzug gegen die Palästinenser“, welche im „Freiluftkonzentrationslager Gazastreifen“ [12] untergebracht werden würden. Auch mit einem „FPÖ-Veto gegen [einen] EU-Beitritt von Türkei und Israel“ – wobei letzterer (bekanntlich) nie Thema war – wurde Werbung gemacht. Die neuerdings ins Feld geführte Israelfreundlichkeit der FPÖ dient demgegenüber rassistischer Instrumentalisierung. Antisemitismus wird dann kritisiert, wenn es der rassistischen Agitation gegen Muslime dient, welche ihn von außen in die österreichische Gesellschaft „importieren“ würden. Diese Strategie ist dem Umstand geschuldet, dass offener Antisemitismus im Vergleich zu antimuslimischen Rassismus tabuisiert ist und soll den Antisemitismus als vermeintlich „fremdes“ Phänomen externalisieren. Eine klare Anti-Globalisierungspolitik stellt einen weiteren ideologischen Bezugspunkt der FPÖ dar. So wurde unter anderem mit dem Slogan „sozial geht nur national“ geworben und das „Europa der Vaterländer“ als „Bollwerk gegen die Globalisierung“ [13] bezeichnet.
Der Bezugspunkt eines neuen Rassismus hat sich von „Rasse“ hin zur „Kultur“ verschoben. Dem homogenisierten Eigenen ist dabei immer der Vorzug zu geben. Die FPÖ sieht sich dabei zur Bewahrung der „eigenen“ Kultur gegen das „rückständige“ Andere verpflichtet. So wird – zum Teil auch jeder kapitalistischen Verwertungslogik widersprechend – gegen Migrant_innen mobilisiert. Vor allem muslimische Migrant_innen sehen sich mit massiver Negativpropaganda konfrontiert. Der Islam sei – laut Johann Gudenus – nicht integrierbar und „solche Leute haben sich eine Einbürgerung nicht verdient“ [14]. Dabei wird häufig auch auf NS-Vokabular zurückgegriffen. Zum Beispiel sprach selbiger von einer stattfindenden „Umvolkung“, welche zu verhindern sei. Auch das Wort „N****“ ist kein Tabu innerhalb der FPÖ, Susanne Winter (mittlerweile wegen offenem Antisemitismus aus der Partei ausgeschlossen) etwa sieht dies nicht als ein Schimpfwort, sondern „als Bezeichnung einer Menschenrasse“ [15].
Die FPÖ ist als Männerpartei auch als antifeministisch und homophob einzustufen. Um das „Eigene“ zu schützen, muss dieses auch gefördert werden. Somit stellt die „österreichische Kleinfamilie“ – da nur diese Kinderreichtum gewährleisten könne – den positiven Bezugsrahmen der freiheitlichen Familienpolitik dar. Dass dabei die Geschlechterrollen klar verteilt sind, versteht sich von selbst. Die FPÖ ist nicht nur Abbild einer patriarchalen Gesellschaft, sondern zielt auf noch striktere Geschlechterrollen ab. Heinz-Christian Strache und Andreas Mölzer sprechen in Interviews gerne von einer „Herrschaft des Feminismus“ und einer „Lobby der Schwulen und Lesben“ [16]. Weiters wird Homosexualität als Krankheit oder als „Kultur des Todes“ [17] bezeichnet.
Anhand der Rechtsextremismustheorie von Willibald Holzer [18] und aufgrund dieser Merkmale ist die FPÖ eindeutig als rechtsextrem zu bezeichnen. Nach dieser Theorie ist der Begriff Rechtsextremismus nicht unbedingt mit dessen Ablehnung der parlamentarischen Demokratie verbunden. Rechtsextremismus wird hierbei vor allem durch die Behauptung einer „natürlichen“ Ungleichheit, verbunden mit der Trias Gemeinschaftsdünkel, Autoritarismus und Rassismus/Antisemitismus bestimmt. Die Verwendung des Begriffes rechtspopulistisch wäre eine klare Verharmlosung dieser menschenverachtenden Politik. Bestimmt man aber den Rechtspopulismusbegriff als politischen Stil und den Rechtextremismus als inhaltlich-ideologisch, so kann eine Partei rechtspopulistisch und rechtsextrem zugleich agieren. Gerade in letzter Zeit versucht sich die FPÖ staatsmännischer zu geben und die Parteispitze versucht in öffentlichen Aussagen und Debatten moderater aufzutreten. Diese Strategie sollte aber keineswegs darüber hinwegtäuschen, dass der ideologische Kern der FPÖ weiterhin ein völkisch-rechtsextremer ist. Auch bedeutet das Arrangement der FPÖ mit der Demokratie als Form keinesfalls, dass die FPÖ eine demokratische Partei ist. Vielmehr artikuliert sich der modernisierte Rechtsextremismus nicht mehr gegen die sondern in der Demokratie. Er will die Demokratie nicht abschaffen, aber im Sinne von Ethnokratie umdeuten. Diese Umdeutungsbestrebungen stehen im Widerspruch zu den aufklärerischen Ideen der Gleichheit des Individuums, da in dieser „identitären“ Demokratie die Gemeinschaft, das Volk, als alleiniger Träger von Rechten über den Einzelnen gestellt wird. [19] Die Charakterisierung der FPÖ als rechtsextrem bedeutet jedoch nicht, dass ihre Wähler_innen, ja nicht einmal ihre Funktionär_innen und Mitglieder, allesamt Rechtsextreme wären. Dennoch muss der idelologische Charakter der Partei ernst genommen und die inneren Widersprüche, welche wie oben ausgeführt auch immer wieder zu Brüchen innerhalb der Partei führen, in die Kritik miteinbezogen werden. Diese Widersprüchlichkeit macht sich auch in der Wirtschaftspolitik der FPÖ bemerkbar, in der ein fetischisierter und ressentimentgeladener „Antikapitalismus“ mit neoliberalen Programmatiken kollidiert. Die FPÖ als „neoliberale“ Partei zu kritisieren, ist eine falsche Vereindeutigung und dient der linken Selbstvergewisserung, dass die Thematisierung der „soziale Frage“ stets das alleinige Terrain der Linken wäre.
Dass mit solchen Inhalten in einem postnazistischen Land so erfolgreich Politik gemacht werden kann und mit der FPÖ Koalitionen eingegangen werden, ist bezeichnend. Es zeigt abermals auf, dass solche Positionen gesellschaftsfähig sind und nicht im luftleeren Raum herumirren. Das Problem heißt daher auch nicht FPÖ, sondern Österreich!
Was tun?
Die FPÖ ist keine rechtsextreme Randgruppe, der man mit den herkömmlichen antifaschistischen Aktionen beikommen könnte. Natürlich sind Gegenmobilisierungen zu ihren strategisch wichtigsten Events sinnvoll, ihre Wahlkämpfe könnten auch noch stärker und kreativer begleitet werden. Dennoch setzt innerhalb der antifaschistischen Linken eine Mischung aus Frustration und Gewöhnung ein. Frustration, da der FPÖ kein aktiver Schaden zugefügt werden kann und wir zu wenige sind. Gewöhnung, weil es den Anschein hat, dass rechtsextreme Aussagen zum Alltag geworden sind und keinen großen Skandal mehr hervorrufen. Die Politik greift die Debatten der Rechtsextremen auf, äußert Verständnis für die „Ängste der Bürger“. Ganz so, als sei es eine Naturnotwendigkeit, dass bei ein paar tausend Flüchtlingen der österreichischen Bevölkerung Angst und Bange wird. Viele Forderungen der FPÖ wurden und werden von den Regierungsparteien umgesetzt. Angesichts der österreichischen Zustände steht die antifaschistische Linke diesen Entwicklungen fast schon hilflos gegenüber. Dabei wäre der Kampf gegen die FPÖ gerade ein Kampf gegen jene österreichischen Zustände, in der autoritäre Einstellungen weit verbreitet sind. Und das macht die Sache auch so schwierig.
Auch in Bezug auf die aktuellen Debatten um Grenzzäune und Asylrechtsverschärfungen bleibt die radikale Linke merkwürdig stumm. Der Großteil des linken Protests schöpft sich in Forderungen und Petitionen, die auf den Staat gerichtet sind. Genau hier zeigt sich erneut die Schwäche und Ohnmacht der radikalen Linken: Anstatt zu versuchen, den zivilgesellschaftlichen Protest zu radikalisieren und die inneren Widersprüche aufzuzeigen, wird sich mit der eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit identifiziert und der Staat, dessen Grenzregime für dieses Schlamassel erst verantwortlich ist, wird angerufen doch endlich zu handeln.
Die aktuellen Herausforderungen der radikalen Linken stellen sich für uns wie folgt da: Wie können antifaschistische und antirassistische Abwehrkämpfe besser und zielgerichteter geführt werden? Und – vor allem – wie kann es geschafft werden, über diese Abwehrkämpfe hinaus zu kommen? Und wie lassen sich diese Kämpfe transnational organisieren? Betrachtet man die aktuelle gesellschaftliche Situation, so erscheint eine rechte Konterrevolution nicht nur als eine Möglichkeit, sondern muss vielmehr als eine realistische Option betrachtet werden. Die Wahlerfolge der FPÖ in Österreich, des Front National in Frankreich oder der AfD in Deutschland – ganz zu schweigen von Ungarn, dessen völkisches Krisenmanagement große gesellschaftliche Bereiche durchdrungen hat – schaffen es, rechtsextreme Positionen in der Gesellschaft hegemonialer werden zu lassen. Die Grenze des Sagbaren wird immer weiter nach rechts verschoben. Europäische Faschist_innen basteln derweilen an der völkischen Neukonzeption Europas und wittern Morgenluft. Hier muss eine antifaschistische Linke neue Strategien entwickeln, wie man diesem gesellschaftlichen Rechtsruck begegnen kann. Die Beantwortung dieser Frage hängt unmittelbar mit der zweiten zusammen. Angesichts der Schwäche der radikalen Linken in Österreich müssen wir Aufbauarbeit leisten. Nach dem Aufbau einer handlungsfähigen radikalen Linken, einer langwierigen und leisen politischen Arbeit, müssen wir raus aus der Szene und rein in das Handgemenge der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Die radikale Linke muss wieder an den Alltagserfahrungen und Kämpfen ansetzten und dabei ein Angebot schaffen. Sie muss Kämpfe vernetzen und politisieren und sich dabei einer Arbeitsteilung untereinander bewusst werden.
Beispielsweise müsste es geschafft werden, Geflüchtete als politische Subjekte ernst zu nehmen und hier Verbindungslinien zwischen unseren Kämpfen um ein besseres Leben jenseits von nationalstaatlichen Grenzregimen und kapitalistischer Ausbeutung herzustellen.
Denjenigen, die es unter Einsatz ihres Lebens schaffen, die tödlichen Grenzen der Festung Europa zu überwinden, wird hier staatlich organisiert das Leben zur Hölle gemacht. Sie werden zur Untätigkeit verdammt und in die gesellschaftliche Isolation gedrängt, sind dem alltäglichen Rassismus ausgesetzt und müssen in unterbezahlten prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Hier gibt es genug Anknüpfungspunkte, um keine Stellvertreter_innenpolitik zu führen, sondern unsere gemeinsamen Interessen zu verbinden und in unseren Kämpfen zu bündeln. Eine emanzipatorische Linke muss diese Debatte weiterführen und Handlungsperspektiven eröffnen. Wir laden alle dazu ein, sich gemeinsam mit uns diesen Herausforderungen zu stellen! Gelegenheiten wird es dazu genug geben.
Begriffsbestimmung Rechtsextremismus
Wir sind uns der Problematik, die mit dem Begriff des Rechtsextremismus zusammenhängt, bewusst. Wir beziehen uns hier auf den Rechtsextremismusbegriff, den das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) verwendet und der von Willibald I. Holzer ausformuliert wurde (Willibald I. Holzer: Rechtsextremismus. Konturen, Definitionsmerkmale und Erklärungsansätze. In: DÖW (Hrsg.): Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus. Wien, 1993). Holzer verwendet den Begriff nicht im Sinne einer totalitarismustheoretischen Gegenüberstellung von Rechts- und Linksextremismus, sondern als Terminus, in dem sich unterschiedliche Definitionsmerkmale bzw. Ideologeme zu einem Idealtypus (Max Weber) verdichten. Rechtsextreme Einstellungen werden so nicht als das ganz andere der „guten“ Mitte begriffen, sondern als extreme Steigerungsform bürgerlicher Wertevorstellungen. Aber warum konnte sich in Österreich ein ganz anderer Begriff des Rechtsextremismus durchsetzen als in Deutschland? Eine Differenzierung in „rechtsextremistisch“ oder „linksextremistisch“ wird in Deutschland entlang des Verhältnisses zur FDGO bestimmt. In Österreich gibt es aber in der Verfassung eine explizite Antinazigesetzgebung, nämlich die gegen NS-Wiederbetätigung (Verbotsgesetzt). Gleiches gibt es nicht für links. Diese Gesetzgebung führte aber auch dazu, dass Nazi nur genannt werden darf, wer gegen das Verbotsgesetz verstößt. Wer nicht dementsprechend verurteilt wird, da er eine strafbare Handlung gesetzt hat und dennoch Nazi genannt wurde, kann Anzeige wegen Verleumdung stellen, was entsprechend häufig geschah. Die Folge daraus war, dass ein Ersatzbegriff für (noch) nicht verurteilte Nazis entwickelt wurde, was schließlich zur inhaltlichen Ausdifferenzierung des Rechtsextremismusbegriff führte.
* Der Begriff „Buberlpartie“ spielt mit homoerotischen Anklängen auf eine (fast) reine Männergruppe an. Diese kamen aus dem direkten Umfeld von Haider und waren keiner Burschenschaft angehörig – hatten also keine direkte Verbindung zum Deutschnationalismus.
[1] http://autonome-antifa.net/index.php/20 … ylpolitik/
[2] http://keinspielfeld.noblogs.org/
[3] vgl. Heribert Schiedel (2007): Der rechte Rand.
[4] Hubert Stickinger, Jörg Haider; In: Anton Pelinka u.a., Kreisky – Haider. Bruchlinien österreichischer Identität (2008)
[5] J. Haider im Interview mit Die Presse (22.11.1989)
[6] Parteiprogramm der FPÖ (2005)
[7] H.C. Strache im Interview mit den Salzburger Nachrichten (26.11.2004)
[8] H.C. Strache im Interview mit der Austria Presse Agentur (APA) (2009)
[9] Parteiprogramm der FPÖ (2005)
[10] H. Vilimsky in einer APA-OTS (15.4.2009)
[11] H. Vilimsky in einer APA-OTS (2.5.2008)
[12] Heinz Thomann in Zur Zeit (16/2009)
[13] A. Mölzer in einer APA-OTS (4.4.2008)
[14] J. Gudenus im Interview mit dem Standard (25.8.2010)
[15] S. Winter im Interview mit dem Falter Steiermark (5/2007)
[16] A. Mölzer, Europa 2084. Orwell lässt grüßen – Kasandrarufe – der „worst case“ (2009)
[17] K. Klement im Interview mit profil (23.6.2008)
[18] Willibald Holzinger, Rechtextremismus. Konturen, Definitionsmerkmale, und Erklärungsansätze, In: Handbuch des österreichischen Widerstands (1993)
[19] Heribert Schiedel (2014): „National und liberal verträgt sich nicht“. Zum rechtsextremen Charakter der FPÖ. In: Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (FIPU): Rechtsextremismus. Entwicklungen und Analysen – Band 1